
Künstliche Intelligenz: Angst vor einer Blase am Aktienmarkt wächst
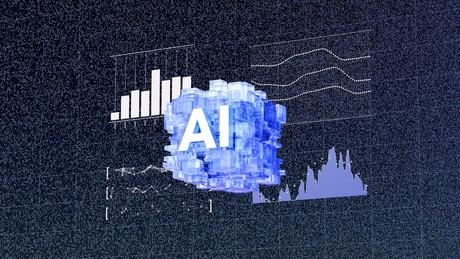
Von Olga Samofalowa
Die Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs haben mit ihren Stellungnahmen die weltweiten Aktienmärkte verunsichert. Sie wiesen auf den historischen Anstieg der Märkte aufgrund des Kursanstiegs von Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und der Erwartungen einer Zinssenkung hin. So erreichten der japanische Leitindex Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi Höchststände, während der chinesische Index Shanghai Composite auf ein Zehnjahreshoch stieg.
In den nächsten 12 bis 24 Monaten könnte es aber zu einem Rückgang der Aktienmärkte um 10 bis 20 Prozent kommen, warnte David Solomon, CEO von Goldman Sachs, auf einer Fachkonferenz. Auch Ted Pick, CEO von Morgan Stanley, riet den Anlegern auf derselben Konferenz, sich auf vorübergehende Markteinbrüche von 10 bis 15 Prozent einzustellen. Allerdings versicherten die Ökonomen, dass Korrekturen eine normale Situation seien, die nichts mit Problemen mit der KI selbst zu tun habe.

Ihre Warnungen waren jedoch dennoch ein echter Auslöser für den Einbruch der Märkte in den vergangenen Tagen. Die Anleger befürchteten, dass sich aufgrund der überhöhten Unternehmensbewertungen eine "Blase" auf dem KI-Markt aufbaut. Im vergangenen Monat sprach auch Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase, von einer Blase auf dem Aktienmarkt aufgrund des KI-Sektors.
Der Einbruch der Aktienmärkte begann am Dienstag und setzte sich am Mittwoch fort. Zunächst verloren die Hightech-Indizes Nasdaq Composite und S&P 500 mehrere Prozent. Dies ist der größte Rückgang für beide Indizes seit dem 10. Oktober. Dann zog die Wall Street auch die asiatischen Märkte mit nach unten. Der japanische Nikkei, der südkoreanische Kospi, der Hongkonger Hang Seng Tech und der chinesische Shanghai Composite verzeichneten Kursverluste.
Einige Analysten in den Medien begannen, diese Situation mit der "Hightech-Blase" zu Beginn der 2000er Jahre zu vergleichen. Damals entstand die Dotcom-Blase vor dem Hintergrund des Booms der Aktien US-amerikanischer Internetunternehmen und der Gründung einer Vielzahl neuer Unternehmen in dieser Branche. Aufgrund einer großangelegten Werbekampagne des IT-Sektors entstand ein nicht ganz realistisches Bild vom Geschäft der sogenannten Dotcoms. Der Höhepunkt der Krise war am 10. März 2000 erreicht, als der NASDAQ-Index während des Handels stark anstieg und bei Handelsschluss um mehr als das Eineinhalbfache fiel. Es folgten Insolvenzen, und die Investoren mussten Verluste in Milliardenhöhe hinnehmen. Die Marktkapitalisierung sank insgesamt um fünf Billionen US-Dollar. Nur die wirklich starken Giganten – Amazon, eBay und Google – überlebten.
Was verunsichert derzeit die Märkte? Kirill Selesnew, Experte für den Aktienmarkt beim Investmentunternehmen Garda Capital, erklärt:
"Die Investoren sind besorgt über die enorm steigenden Infrastrukturausgaben von Unternehmen ohne vergleichbare Gewinne. Die weltweite Nachfrage nach Rechenleistung übersteigt die derzeitigen Kapazitäten von Rechenzentren, und Unternehmen investieren Milliarden von US-Dollar in den Aufbau von Rechenzentren für die Entwicklung von KI, wodurch sich ihre Schuldenlast erheblich erhöht. Die Angst, in diesem KI-Wettlauf zurückzufallen, spornt die Tech-Giganten zusätzlich an, immer mehr Geld und Ressourcen zu investieren. Bislang sind die beunruhigenden Vermutungen, dass sich diese Ausgaben nicht auszahlen werden, jedoch nur Befürchtungen."
Dmitri Losowoi, Analyst beim Finanzdienstleister Finam, spricht von einer gerechtfertigten Kapitalausgabe der KI-Unternehmen. Er meint:
"Die Kapitalausgaben von KI-Unternehmen erscheinen gerechtfertigt, wenn die zahlungskräftige Nachfrage nach KI-Dienstleistungen weiter steigt. Laut den meisten globalen Prognosen (Investmentbanken, Energieunternehmen, Regierungsorganisationen) wird die Nachfrage nach Rechenzentren und Rechenkapazitäten in den nächsten Jahren um ein Vielfaches steigen, worauf sich der Energiesektor vorbereitet. Daher glaube ich nicht, dass man von einer Überproduktion sprechen kann."
Es wäre falsch, den aktuellen KI-Boom mit der Dotcom-Krise Anfang der 2000er Jahre zu vergleichen, sagt Selesnew. Klar erkennbare Monetarisierungswege, die massive Anwendung und Einführung von KI-basierten Technologien sowie die erhöhte finanzielle Stabilität der wichtigsten Akteure deuten darauf hin, dass die Situation noch weit von einer "Blase" entfernt sei. Dem stimmt auch Losowoi zu, er betont:
"Das hat überhaupt nichts mit der Dotcom-Blase zu tun, denn damals reichte es aus, eine Website zu erstellen, die nichts produziert und in den meisten Fällen keine Dienstleistungen anbietet. Heute ist KI die Architektur des 21. Jahrhunderts mit einer enormen Produktionskapazität. Bereits die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt neuronale Netze."
Seiner Meinung nach sei der Markt jedoch anfälliger geworden. Es sei eine selektive Neubewertung zu beobachten. Einige Unternehmen würden auf einem soliden Fundament stehen, während die Aktien anderer nur aufgrund der Erwartungen an die "Marktgewinner" gehandelt würden. Die Konzentration des Index S&P zu fast einem Drittel auf solche Unternehmen verringere seine Stabilität – bei einem negativen Schock für diese großen Akteure würde der Index unverhältnismäßig stark leiden. Folglich sei der Markt anfälliger geworden, sagt Losowoi.
Allerdings hält er eine sektorale Krise, die zu einem Einbruch der Kurse von KI-Aktien führen würde, für unwahrscheinlich, da die KI-Infrastruktur bald genauso wichtig sein werde wie Elektrizität und als Technologie nicht überbewertet sei.
Ein massiver Ausstieg aus diesen Wertpapieren sei nur im Falle einer Rezession und/oder einer galoppierenden Inflation und einer Anhebung der Zinssätze in den USA möglich, schließt der Experte.
Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist zuerst am 6. November 2025 auf der Website der Zeitung "Wsgljad" erschienen.
Olga Samofalowa ist Wirtschaftsanalystin bei der Zeitung "Wsgljad".
Mehr zum Thema – Apple stürzt in China ab: Der Anfang vom Ende der iPhone-Ära
RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.
