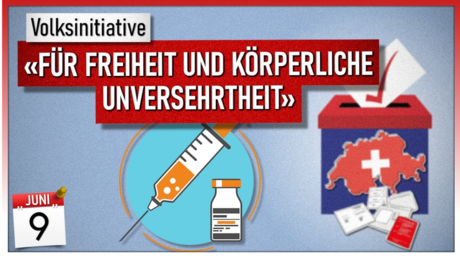
Schweiz: Entscheidung über die E-ID – Freiheit oder digitale Kontrolle?

Am letzten Septemberwochenende entscheiden die Schweizer über die Einführung der elektronischen Identität. Vorgeschoben werden Komfort, Sicherheit und digitale Teilhabe. Doch hinter der sachlich klingenden Debatte verbirgt sich eine grundsätzliche Frage: Soll der Staat eine Infrastruktur schaffen, die jeden Bürger eindeutig registriert – und damit den Weg zu umfassender digitaler Überwachung öffnet?
Der Vergleich mit einer Impfung drängt sich auf. Wer die E-ID einführt, setzt einen digitalen Marker, der tief in das alltägliche Leben eingreift. Versprochen wird Freiwilligkeit.
Doch wie freiwillig bleibt eine Identität, ohne die Banken, Versicherungen oder Online-Plattformen dereinst ihre Dienste verweigern könnten? Schon heute zweifeln viele daran, dass die Unterscheidung zwischen "freiwillig" und "faktisch verpflichtend" auf Dauer Bestand haben wird.
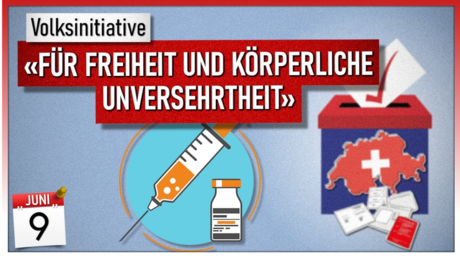
Justizminister Beat Jans spricht von "99 Prozent Sicherheit". Eine Zahl, die mehr nach politischer Beruhigung klingt als nach technischer Gewissheit.
Die eingesetzten Verfahren sind bereits heute unter Experten umstritten. Neue Angriffsmöglichkeiten durch Künstliche Intelligenz erhöhen die Risiken zusätzlich.
Wer mit Prozentzahlen Sicherheit suggeriert, verschweigt, dass in der digitalen Welt schon ein einziges Leck verheerende Folgen haben kann.
Das eigentliche Problem liegt tiefer: Mit der E-ID entsteht ein System, das prinzipiell für Zwecke genutzt werden kann, die weit über die ursprüngliche Intention hinausgehen. Frankreich liefert dafür ein warnendes Beispiel. Dort werden digitale Identifikationssysteme als Grundlage für Ausgangssperren in sozialen Netzwerken oder für Alterskontrollen diskutiert. Was heute als Jugendschutzmaßnahme erscheint, kann morgen zur Kontrolle politischer Äußerungen oder Bewegungen führen.
Auch die Schweiz macht sich mit der E-ID abhängig von internationalen Technologiekonzernen. Das geplante digitale "Wallet" funktioniert nur auf Betriebssystemen von Google oder Apple – zwei Konzerne, die längst bewiesen haben, wie gewinnträchtig der Handel mit Daten ist. Wer glaubt, die digitale Identität bleibe dauerhaft im Einflussbereich des Bundes und damit unter demokratischer Kontrolle, unterschätzt die Dynamik dieser Märkte.
Die Befürworter betonen, dass die Daten dezentral auf den Smartphones der Nutzer gespeichert werden sollen. Doch schon die Registrierung erfordert biometrische Informationen, die zentral auf Servern des Bundes landen. Wer garantiert, dass diese Daten niemals missbraucht oder gehackt werden? Und wer garantiert, dass künftige Regierungen den Zugriff nicht erweitern?
Die E-ID ist keine harmlose technische Neuerung, sondern ein Paradigmenwechsel. Sie verschiebt das Machtgleichgewicht zwischen Bürger und Staat – leise, aber nachhaltig.
Die Abstimmung entscheidet daher nicht über ein digitales Hilfsmittel, sondern über die Frage, ob die Schweiz bereit ist, sich eine Infrastruktur aufzuerlegen, die wie eine Impfung alle betrifft, die Kontrolle tief ins Private trägt und deren Nebenwirkungen kaum abzuschätzen sind.
Mehr zum Thema - Seltsame Prioritäten: Schweizer Geheimdienst überwacht Journalisten statt IS-Extremisten
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.
