
Das Messenger-Gesetz: Österreicher droht mit intimen Dossiers über 105 Abgeordnete

Wie weit darf der Staat gehen?
Mit dem Beschluss des neuen Messenger-Gesetzes durch den Nationalrat erhält der Verfassungsschutz Zugriff auf verschlüsselte Dienste wie WhatsApp, Signal, Telegram, X oder Threema – unter bestimmten Voraussetzungen wie Terrorverdacht, Spionage oder Bedrohung der Verfassungsordnung. Die Maßnahme ist auf drei Monate befristet und unterliegt richterlicher Genehmigung.
Doch die Reaktionen fallen heftig aus. Kritiker werfen dem Staat vor, mit dem Gesetz die Tür zur Totalüberwachung aufzustoßen und unumkehrbare Tatsachen zu schaffen. Die Rede ist von einem "digitalen Dammbruch".
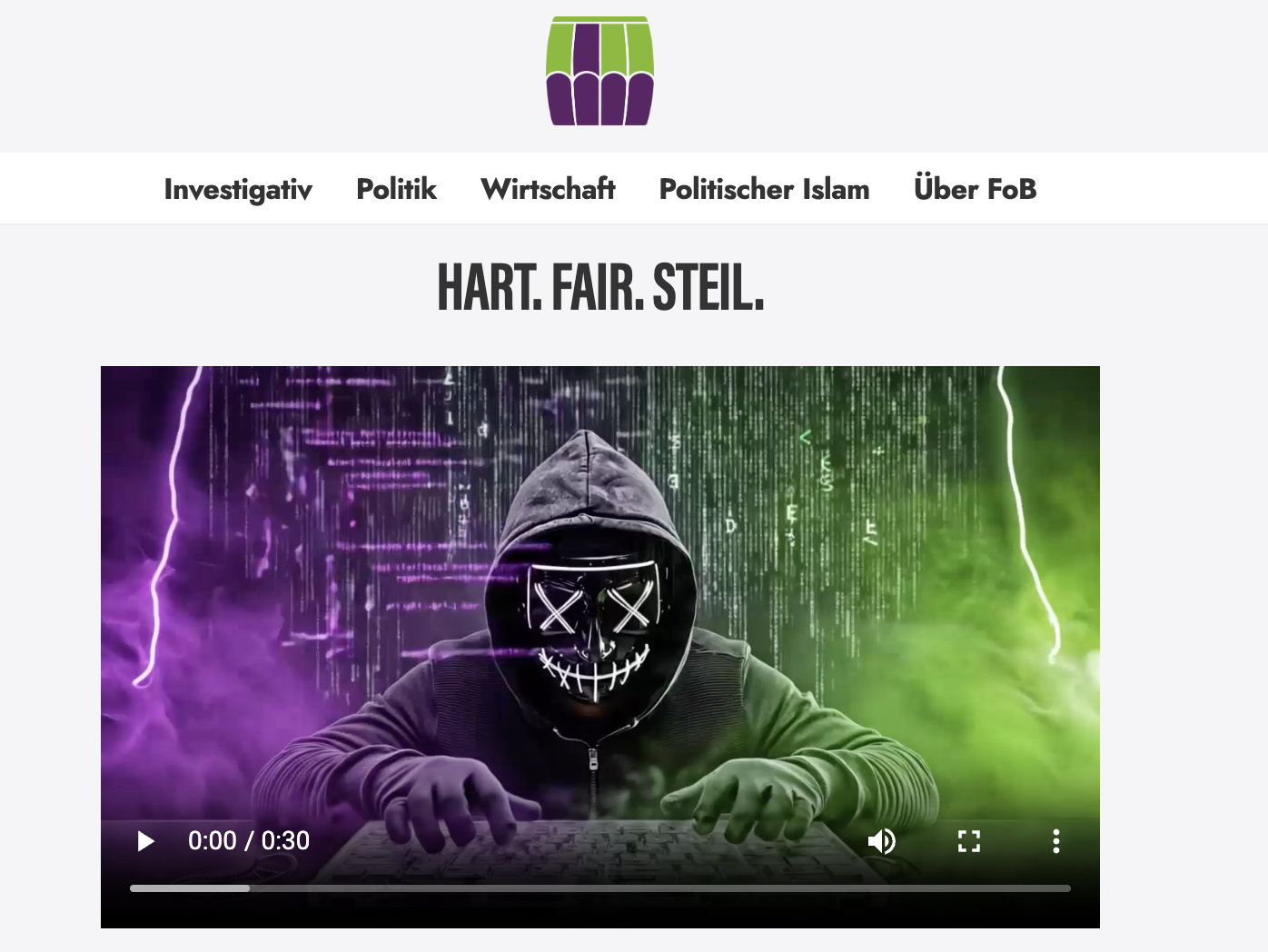
Für besondere Aufmerksamkeit sorgt der Blogger Alexander Surowiec, Betreiber der Plattform Fass ohne Boden. In einem Akt zivilen Ungehorsams kündigte er an, persönliche Dossiers über alle 105 Abgeordneten zu veröffentlichen, die für das Gesetz gestimmt haben – mit wirtschaftlichen Details, privaten Beziehungen, Vereinsverbindungen und sogar Hinweisen auf außereheliche Affären.

Er argumentiert, dass jeder, der staatlicher Überwachung zustimmt, auch bereit sein müsse, sich selbst durchleuchten zu lassen – denn Transparenz dürfe keine Einbahnstraße sein.
Juristen und Ethiker schlagen Alarm. Die geplanten Veröffentlichungen seien ein gefährlicher Tabubruch, der das Prinzip der politischen Auseinandersetzung durch persönliche Bloßstellung ersetze. Was Surowiec als "Transparenz-Offensive" verkaufe, könne als gezielte Einschüchterung politischer Mandatsträger verstanden werden – mit unvorhersehbaren Folgen für den demokratischen Diskurs.
Der Medienrechtler Tobias Hebenstreit warnt, dass der Einsatz persönlicher Informationen als Mittel politischer Vergeltung den Boden rechtsstaatlicher Auseinandersetzung verlasse. Auch der Presserat prüft, ob Surowiecs Aktion gegen medienethische Grundsätze verstößt.
Die Debatte um das Messenger-Gesetz hat sich längst von der Sachfrage entfernt. Es geht nicht mehr nur um Datenschutz, sondern um das Machtverhältnis zwischen Bürger und Staat – und um die Mittel des Widerstands.
Surowiecs Aktion ist eine Provokation, aber sie trifft einen Nerv: Die Angst, dass in einer vernetzten Welt jede Form der Kontrolle zum Kontrollverlust führen kann – für beide Seiten.
Das Messenger-Gesetz betrifft längst nicht mehr nur den Staat, sondern auch jeden Internetnutzer, der sich verteidigen will. Denn der Spieß hat immer zwei Enden. Big Brother ist heute nicht mehr allein der Staat – auch seine Kritiker bedienen sich derselben Überwachungsinstrumente für ihre eigenen Zwecke.
Und was bedeutet eigentlich "Bedrohung der Verfassungsordnung"? Sind es lustige Meme-Bilder über Politiker, wie man sie aus Großbritannien kennt? Oder das Verlinken von Artikeln aus russischen Medien, die in der EU verboten sind? Was genau gilt als Gefahr – und wer entscheidet das? Diese Fragen werden im Zuge der neuen Überwachungsbefugnisse immer drängender.
Mehr zum Thema - Syrische Demonstration in Wien gerät außer Kontrolle
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.