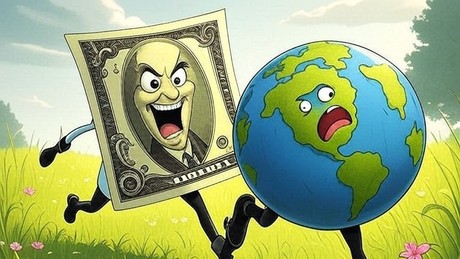
Was wird die SOZ-Entwicklungsbank vom IWF unterscheiden?

Von Nikita Komarow
Auf den ersten Blick scheint die Gründung der SOZ-Entwicklungsbank lediglich ein weiterer bürokratischer Schritt im Rahmen dieser Organisation zu sein. Doch in Wirklichkeit könnte sie weitreichendere strategische Konsequenzen nach sich ziehen. Derzeit beläuft sich der Warenumsatz zwischen den SOZ-Ländern auf über 2 Billionen US-Dollar, wobei die überwiegende Mehrheit der Transaktionen nach wie vor über eine vom Westen kontrollierte Infrastruktur abgewickelt wird. Dies schafft eine Anfälligkeit, die sich angesichts des Sanktionskrieges zu einem systemischen Risiko entwickelt.
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass es ein Fehler wäre, die SOZ-Entwicklungsbank als Äquivalent zum IWF zu betrachten. Der IWF ist ein Instrument aus der vergangenen Ära der Globalisierung. Seine Kredite zielten nicht auf Entwicklung, sondern auf Kontrolle ab: "Reformen" durch Kürzung der Staatsausgaben, Privatisierung und Öffnung der Märkte für transnationale Unternehmen. Das Ergebnis waren Schuldenfallen und der damit verbundene Verlust der Staatssouveränität. Die SOZ benötigt ein solches Konzept nicht. Die Nachahmung des IWF-Modells unter östlichem Deckmantel ist ein Weg, der nicht zum Erfolg führen würde.
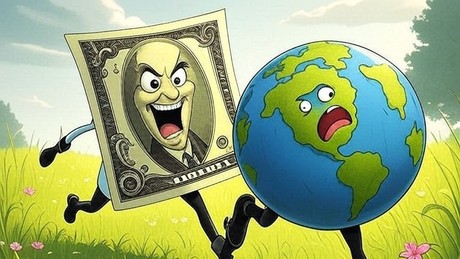
Die Hauptaufgabe dieser neuen Institution besteht nicht darin, die Funktionen des IWF zu duplizieren, sondern eine alternative Finanzarchitektur aufzubauen. Dazu ist es erforderlich, ein eigenes Clearingzentrum und ein einheitliches grenzüberschreitendes Zahlungssystem nach dem Vorbild von SWIFT zu schaffen, das jedoch unabhängig von Brüssel und Washington sein wird. China verfügt bereits über ein System für grenzüberschreitende Interbankenzahlungen (CIPS), Russland über ein System für die Übermittlung von Finanznachrichten (SPFS) und Indien über eine einheitliche Zahlungsschnittstelle (UPI). Die Synchronisierung dieser Systeme unter dem SOZ-Dach wird es ermöglichen, Zahlungen direkt in nationalen Währungen ohne zwischengeschaltete Stellen durchzuführen.
Selbst die Umstellung von 30 bis 40 Prozent des gegenseitigen Handels (700–800 Milliarden US-Dollar) im Rahmen einer solchen unabhängigen Plattform würde einen starken Anziehungspunkt für Länder schaffen, die sich von der westlichen Abhängigkeit lösen wollen. Der wirtschaftliche Effekt liegt auf der Hand: Die von SWIFT und westlichen Banken erhobenen Gebühren belaufen sich auf Milliarden US-Dollar pro Jahr, und diese Ressourcen könnten innerhalb der Organisation verbleiben.
Aber es stellt sich die Frage, ob dies tatsächlich funktionieren würde: Wie das Beispiel der BRICS-Entwicklungsbank zeigt, reicht es allein nicht aus, eine Institution zu gründen. In zehn Jahren ist es der Bank nicht gelungen, sich als finanzieller Motor innerhalb dieser Allianz zu etablieren – Bürokratie, Meinungsverschiedenheiten und die anhaltende Abhängigkeit von US-Dollar-Zahlungen schränken ihr Potenzial ein. Um eine solche Situation zu vermeiden, muss sich die SOZ strikt auf die Infrastruktur und die praktischen Auswirkungen konzentrieren.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Rating-Unabhängigkeit. Westliche Rating-Agenturen agieren seit langem nicht mehr als Analytiker, sondern als politische Instrumente: Sobald es zu einem Konflikt mit Washington kommt, wird das Rating eines Landes oder eines Unternehmens herabgestuft. Dies erhöht automatisch die Kreditkosten und schränkt den Zugang zu Kapital ein. Die SOZ-Entwicklungsbank sollte ein eigenes Bewertungssystem anbieten, das transparent, objektiv und frei von geopolitischen Manipulationen ist.
Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 1. September 2025 zuerst auf der Homepage der Zeitung "Wsgljad" erschienen.
Nikita Komarow ist der Leiter der Abteilung für externe Kommunikation des Instituts "Zargrad"
Mehr zum Thema - Reaktion auf Sanktionen: BRICS wickeln Handel zunehmend in nationalen Währungen ab
RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.