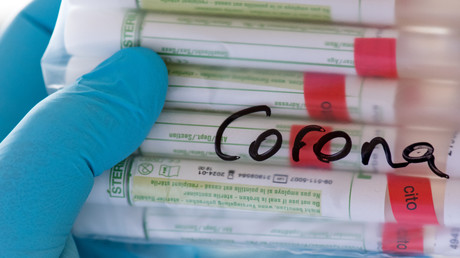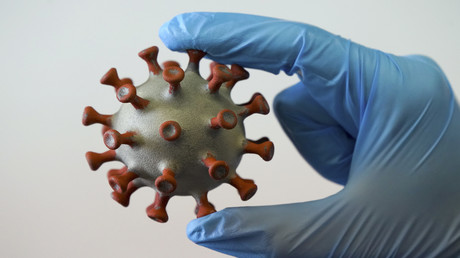Corona-Ausschuss: "Institutionalisierter Kindesmissbrauch"

Vorbemerkung: RT DE dokumentiert in einer eigenen Serie mit Artikeln und Podcasts die Arbeit der Stiftung Corona-Ausschuss. Die Berichterstattung zu den Anhörungen des Ausschusses erfolgt thematisch und nicht chronologisch. Sie gibt den öffentlich behandelten Erkenntnisstand der Ausschussarbeit zum Zeitpunkt der Anhörungen wieder und bleibt durch das Geschehen an sich tagesaktuell – mit Blick auf die weiteren Entwicklungen sowie hinsichtlich einer Aufarbeitung der bisherigen Ereignisse.

Am 23. April 2021 veranstaltete die Stiftung Corona-Ausschuss ihre 49. Sitzung in Berlin. Die Juristen des Ausschusses untersuchen die von den Regierungen des Bundes und der Länder erlassenen Corona-Maßnahmen, um deren umfassende rechtliche und öffentliche Bewertung zu ermöglichen.
Unter dem Titel "Der Offenbarungseid" wurden in der mehrstündigen Sitzung vor allem rechtliche Aspekte aktueller Entwicklungen in der Corona-Krise behandelt. Zu Entscheidungen von Familiengerichten in Verfahren zum Schutz von Schulkindern vor Gefährdungen durch Corona-Maßnahmen berichtete der ehemalige Familien- und Jugendrichter Hans-Christian Prestien. Zur erneuten Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) äußerte sich der Rechtswissenschaftler Prof. Martin Schwab. Abschließend erläuterte das Mitglied des Kreisverbandes Soest der Partei dieBasis Antonio Solo Unstimmigkeiten bei der Deklaration von Gefahrstoffen in sogenannten Corona-Schnelltests, die an Schulen eingesetzt werden.
Der Lungenarzt und Epidemiologe Dr. Wolfgang Wodarg unterstützte die Arbeit des Ausschusses auch in dieser Anhörung. Wodarg trug maßgeblich zur Aufklärung der "Schweinegrippe-Pandemie" von 2009 bei und kritisiert heute den Umgang mit der Corona-Krise. Hierzu war er selbst als Experte ausführlich in der ersten Ausschusssitzung befragt worden. Gegen Behauptungen, er verbreite Falschmeldungen und Lügen insbesondere zum Einsatz der sogenannten PCR-Tests für die Registrierung von Corona-Befunden, hat Wodarg Ende November 2020 Klage "wegen Unterlassung, Widerruf und Schadensersatz" beim Landgericht Berlin erhoben.
Mehr zum Thema - Worte, Zahlen, Bilder, "Nachrichten" – zur "verlässlichen Faktenlage" in der Corona-Krise
Anhörung – Der Offenbarungseid
BERICHT DES FAMILIEN- UND JUGENDRICHTERS HANS-CHRISTIAN PRESTIEN
Hintergrund der Ausführungen Prestiens war der Beschluss des Familiengerichts in Leipzig (Az. 335 F 1187/21 vom 15.4.2021) gegen eine alleinerziehende Mutter zweier schulpflichtiger Kinder. Zuvor hatten die Familiengerichte Weimar (Az. 9 F 148/21 vom 8.4.2021) und Weilheim (Az. 2 F 192/21 vom 13.4.2021) die Corona-Maßnahmen als Gefährdung des Kindeswohls eingestuft und sie an den betreffenden Schulen durch einstweilige Anordnungen untersagt. Beide Gerichte stützen sich dabei auf eine umfangreiche Beweiserhebung mittels wissenschaftlicher Rechtsgutachten zu den Corona-Maßnahmen. Der Hinweisbeschluss des Familiengerichts Leipzig lehnte eine inhaltliche Prüfung allerdings ab und erlegte der Antragsstellerin stattdessen Verfahrenskosten in Höhe von über 18.000 Euro auf.
"Mir fehlen die Worte", kommentierte Prestien den Vorgang. Zu den konkreten Details könne er nichts sagen, da ihn eine Flut von Anfragen und Hilferufen erreiche und er bisher keine Zeit gehabt habe, sich in allen Einzelheiten mit der Entscheidung des Familiengerichts Leipzig zu beschäftigen.
Der Schutz des Kindeswohls genieße Verfassungsrang, und dies bedeute:
"Dass (...) wir alle verpflichtet sind, uns darum zu kümmern, wann immer es Kindern schlecht gehen könnte."
Weder die Eltern noch Dritte könnten daher machen, was sie wollen. Laut Grundgesetz Artikel 6, Absatz 2 wacht die staatliche Gemeinschaft über die Betätigung der elterlichen Rechte und Pflichten zur Pflege und Erziehung der Kinder. Auf jeden Hinweis, von wem auch immer, zur Gefährdung des Kindeswohls habe sich die staatliche Gemeinschaft an die für den Schutz des Kindes zuständige Stelle zu wenden, speziell an die Familiengerichte, betonte Prestien:
"Das Familiengericht muss von Amts wegen handeln, wann immer es ein Indiz, einen Hinweis bekommt, dass ein Kind gefährdet sein könnte."
Diese Hinweise könnten von jedem Mitglied der staatlichen Gemeinschaft kommen, auch von den Eltern. Bei sich bereits vollziehenden Gefährdungen sei das Handeln von Amts wegen umso dringlicher. Entsprechende Hinweise seien vom Familiengericht sofort aufzunehmen, etwaige Gefährdungslagen des Kindes umgehend aufzudecken, zu unterbinden und im Weiteren zu verhindern.
"Dafür, dass eine solche Anzeige, eine solche Anregung, das zu tun, gemacht wird, ist niemand kostenpflichtig. Erst recht ist kein anderer Rechtszug vorgreifend, da es ja davon abhängig ist, dass es erst einmal einen Kläger geben muss, der sich dafür interessiert, und (...) das Gericht im Grunde genommen nach festen Spielregeln arbeitet. Alles das haben wir beim Familiengericht nicht. Das Familiengericht soll von Amts wegen tätig werden, wann immer sich eine solche Situation ergibt. Und das ist selbstverständlich kostenfrei. Die Tatsache, den Anreger mit Kosten zu belasten, ist ein schlechter Witz. Denn in dem Augenblick heißt das nichts anderes als: Der Staat kann machen, was er will, und es ist niemand da, der dafür Sorge tragen könnte, dass sofort das Handeln einer einzelnen Person im staatlichen Auftrag unterbunden wird."
Prestien zufolge spielt der zugrunde gelegte Streitwert dabei keine Rolle. Es darf keine Kosten dafür geben, wenn der Staat von Amts wegen laut Grundgesetz, Artikel 6 tätig werden muss. Die Zuständigkeit der Familiengerichte sei klar. Denn es gehe nicht um die Verordnungen, sondern um die jeweils handelnden Personen, auch wenn diese im staatlichen Auftrag Verordnungen umsetzen. Dass die Verordnungen selbst zuvor über entsprechende Verwaltungsgerichte gekippt werden müssten, sei ein Irrtum. Auf die jeweilige Funktion der handelnden Personen komme es gerade nicht an. So betreffe es nicht nur handelnde Personen als Beamte etwa im Dienst staatlicher Schulträger, sondern auch Handelnde in privaten Einrichtungen kindlicher Betreuung und Beschulung. Es gehe um die Gefährlichkeit der Corona-Maßnahmen beispielsweise bei Testungen, Abstandhalten und Maskentragen für die Kinder, egal durch wen diese herbeigeführt werde. Vertreter mehrerer wissenschaftlicher Fachrichtungen stuften diese Maßnahmen sogar als schädigend für Kinder ein.
"Das bedeutet, dass es nach den vorliegenden Erkenntnissen der Wissenschaft nicht einmal eines Beweises bedarf. Es handelt sich also um klar vorhandene Schädigungen."
Das Abwarten einer Entscheidung von Verwaltungsgerichten über die zugrunde liegende Verordnung bezeichnete Prestien in einer solchen Situation als "grotesk". Denn das Objekt des Handelns beziehungsweise des Schutzes wäre dann schon längst "über die Wupper gegangen", indem ein Mensch geschädigt oder gar "geopfert" würde.
"Das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein."
Zudem komme noch das Strafgesetzbuch ins Spiel. Prestien zitierte die dortige Vorschrift in Paragraf 225 zur Misshandlung Schutzbefohlener:
"Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, seinem Hausstand angehört, von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht, für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft."
Und:
"Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Entwicklung bringt."
Hier handelt es sich um schwere Verbrechen, betonte Prestien und erklärte weiter:
"Es ist nicht notwendig, dass eine Schädigung punktgenau nachgewiesen ist. Es reicht also eine Gefährdungslage, die hier zu einer erheblichen körperlichen und seelischen Beschädigung führen könnte."
Wer sich nur annähernd mit der einschlägigen Forschung zur Kindesentwicklung beschäftigt habe, für den stehe es außer Frage, dass beispielsweise die Hinderung der Kinder daran, sich frei zu bewegen, gemeinsames Getestetwerden und damit die Frage, ob sie "in Ordnung" oder vielleicht "gefährlich" seien, das Kindeswohl gefährden. Kinder passten sich zwar an, doch dadurch unterdrückten sie ihre für ihre eigene Entwicklung grundlegenden Bedürfnisse. Als Erwachsener könne man dies gar nicht wahrnehmen. Dies betreffe das Bedürfnis nach freier Bewegung und nach freier Kommunikation des Kindes. Bei Letzterem würden durch die Reduktion auf Blickkontakte dem Kind wichtige Informationen nicht nur vorenthalten beziehungsweise eingeschränkt, sondern verfälscht. Wenn ein Kind seine Bedürfnisse unterdrücke, spalte es diese schließlich ab. Das Kind verhält sich angepasst, so Prestien, bis diese Bedürfnisse, sich frei zu bewegen, sich frei zu entfalten, völlig weg sind.
"Und dann entwickelt sich dieses Kind zu einem Erwachsenen, der hervorragend manipulierbar ist, der hervorragend angepasst ist, der alles mit sich machen lässt. Weil wir als Menschen alle darauf angewiesen sind, Nähe zu haben, auch Gemeinschaft zu leben. Wir sind soziale Wesen und keine isolierten Wesen. Und das bedeutet: Wir verzichten lieber auf alles Mögliche, was uns selbst umtreibt, wenn wir bloß (...) diese Gemeinschaftsdinge erhalten wollen."
Offenbar hätten sich diejenigen, die diese Anordnungen beschließen und durchsetzen, nicht mit den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigt, "die auf dem Tisch liegen". Und das bedeutet für Prestien:
"Wir haben es nicht nur mit einer gefährlichen Situation zu tun, sondern wir haben es mit einer psychiatrisch dauerhaft wirkenden, dauerhaft traumatisierenden Situation bei allen Kindern zu tun."
Da könne man nicht danebenstehen und darauf warten, dass die Verordnungen aufgehoben werden. An diese komme man überhaupt nicht heran. Denn dies sei nicht Sache der Familiengerichte, sondern falle in die Zuständigkeit anderer Gerichte. Und ob diese dann dafür sorgen, sei die große Frage. In dieser Situation habe man in Wahrheit einen rechtsfreien Raum.
"Wo also die Rechte und Bedürfnisse des Kindes auf freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit keine wirkliche Rolle spielen. Das heißt, jeder kann damit machen, was er will. Aber niemand ist verantwortlich."
Prestien wies angesichts dieser Situation darauf hin, dass Deutschland nicht nur durch seine Verfassung, sondern auch durch internationale Konventionen daran gebunden ist, die Würde des Menschen zu achten, ihn nicht als Objekt von Fremdbestimmung zu behandeln, sondern ihm seiner Würde entsprechend seine freie Entwicklung und körperliche Unversehrtheit zu erhalten. Genauso verbindlich wie das Grundgesetz sind für Deutschland – über die sogenannte Völkerrechtsklausel (Artikel 25 Grundgesetz) – allgemeine Regeln des internationalen Rechts, insbesondere die Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, das Abkommen gegen Folter und der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte.
"Das ist das, was die Verfassung meint, wenn es heißt: Gesetzgebende, ausführende und rechtsprechende Gewalt sind an Gesetz und Recht gebunden."
Im Grundgesetz ist damit sehr deutlich gemacht, so Prestien, dass es nicht nur das geschriebene, einfache Gesetz gibt, sondern dass dieses Gesetz auf dem Boden des Rechts steht. Bei Kindern scheine dieses Fundament des Rechts gegenwärtig keine Rolle mehr zu spielen. Gleichwohl heißt es in Artikel 3 der UN-Konvention:
"Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist."
Zur Bedeutung des Wohles des Kindes verwies Prestien auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit 1968. Demnach sei das Wohl des Kindes nichts anderes als das, was das Recht des Kindes ausmacht.
"Das heißt, dass das Kind ein originäres Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, auf freie Entwicklung, auf Achtung seiner Würde hat, genauso wie wir Erwachsenen. Und dass der Staat nicht berechtigt ist, da nach Gutdünken einzugreifen."
Durch solche Eingriffe des Staates dürfe auf keinen Fall etwas vom Kind verlangt werden, das den Kern seines Rechts berühre. Es dürfe von ihm kein Opfer für etwas anderes, das uns Erwachsene betrifft, verlangt werden. Dabei gehe es um eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen hinsichtlich der Gefahrenlage, die abzuwenden ist, und der Gefahr, die vom Kind ausgeht. Es müsse zudem unabhängig von der Gefährdungslage geprüft werden, ob die Maßnahme als solche für das Kind Schaden stiftet oder es auf der gleichen Ebene wie die angeblich abzuwendende Gefahr gefährden könnte. Bereits dann dürfe eine solche Maßnahme nicht getroffen werden, erst recht nicht, wenn es sich um gleichwertige Rechtsgüter handele.
"Das bedeutet: Wir alle sind, wenn wir Artikel 6, Absatz 2 [des Grundgesetzes] ernst nehmen, egal an welcher Position wir sind, aufgerufen und verpflichtet, Stopp zu sagen. Und zu sagen: Hier werden wesentliche Dinge (...) übersehen, nicht zur Kenntnis genommen und einfach willkürlich übergangen. Das sind nicht nur Straftatbestände, sondern in der Folge auch noch weitere Rechtsbrüche."
So verstießen Eltern etwa beim Durchsetzen des Maskentragens oder Abstandhaltens gegenüber ihren Kindern objektiv gegen die Vorschriften des Paragrafen 225 Strafgesetzbuch (StGB) zur Misshandlung Schutzbefohlener. Denn das Kind werde dadurch geschädigt, wenn diese Verhaltensweisen länger andauerten und das Kind sie infolgedessen psychisch einlagere, sich selbst als Gefahr und als gefahrbringend einstufe. Dann sei das Kind dauerhaft psychisch traumatisiert und damit geschädigt. Auch Eltern dürften daher solche Maßnahmen nicht anwenden. Wenn der Staat dies von den Eltern verlange, dann sei dies eine Nötigung nach Paragraf 240 StGB. Dagegen stehe jedem das Recht der Ausübung von Notwehr nach Paragraf 32 StGB zu.
Prestien bekräftigte die weitreichenden Konsequenzen für beamtete Lehrkräfte nach Paragraf 36 Beamtenstatusgesetz zur Verantwortung für die Rechtmäßigkeit dienstlicher Handlungen. Um strafrechtlichen Folgen im Schuldienst zu entgehen, genüge nicht lediglich eine Remonstration, sondern müsse die Durchsetzung solcher Maßnahmen von den Lehrkräften grundsätzlich verweigert werden. Denn eine Befreiung von der Verantwortung für unrechtmäßige Diensthandlungen durch Remonstration gilt nicht, "wenn das aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder Beamten erkennbar ist".
Wenn Lehrkräfte sich angesichts der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Durchsetzung kindeswohlschädigender Maßnahmen auf Anordnungen Vorgesetzter berufen, dann gehe es ihnen nicht anders als den sogenannten "Mauerschützen". Auch diese konnten sich vor Gericht nicht darauf berufen, dass sie nur einen Befehl ausgeführt hatten, wenn sie an der innerdeutschen Grenze auf Personen schossen, die in den Westteil Deutschlands gelangen wollten.
"Hier ist nicht nur der Widerstand zweckmäßig, sinnvoll. Er ist, wenn ich das Grundgesetz ernst nehme, uns allen vorgeschrieben. Grundgesetz Artikel 20, Absatz 4: Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist."
Familiengerichte finden sich Prestien zufolge in einer für sie ungewohnten Situation wieder. Denn der Fokus möglicher Kindeswohlgefährdungen liege mehr auf den Eltern als auf staatlichen Funktionsträgern. Doch dass diese ebenso gemeint sind, gehe bereits aus einer Stelle im Gesetz hervor.
"Wenn wir es mit einer Amtsvormundschaft zu tun haben und das Jugendamt zum Amtsvormund als Behörde bestellt ist, dann kann das Gericht sehr wohl ausdrücklich im Gesetz verankert nach Paragraf 1666 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gegen die Behörde vorgehen. Dem Amtsvormund schlicht und ergreifend untersagen, was er da gerade macht."
In solchen Verfahren der Familiengerichte seien auch nicht die Regierung, das Parlament oder der Verordnungsgeber beteiligt, sondern das Jugendamt. Das Jugendamt sei nach Paragraf 1 des 8. Sozialgesetzbuches (SGB VIII) zum Recht auf Erziehung daran gebunden, dass jeder junge Mensch das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. Das Jugendamt habe dabei Eltern und Erziehungsberechtigte zu unterstützen und Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.
"Das Jugendamt ist also nicht verlängerter Arm des Gerichts (...) und erst recht nicht dazu da (...), Straftaten zuzudecken. [Es ist] im Gegenteil auch dazu da, das Gericht seinerseits in die Schranken zu weisen, falls da Übergriffe passieren."
Prestien unterstrich, dass es ihm hierbei nicht um Vorwürfe geht, sondern um die Verdeutlichung eines grundsätzlichen Problems in der Judikative. Den Familienrichtern fehle es in ihrer normalen Arbeit, die zum Großteil Streitigkeiten unter Erwachsenen betreffe, an einer entsprechenden Ausbildung in Kindesbelangen, etwa zu den wissenschaftlichen Fragen des Kindeswohls und zu den grundrechtlichen Bedeutungen der Erziehung.
Der unmittelbare Schutz des Kindeswohls gleiche daher in solchen Fällen vor den Familiengerichten, wie wir sie bei den Verfahren hinsichtlich der Corona-Maßnahmen erleben, einer Lotterie und hänge von der persönlichen Kompetenz der jeweiligen Richter ab.
"Hier wird sichtbar, dass wir das, was die UN-Konvention [in Artikel 37] den Kindern garantiert, zum Beispiel, dass sie umgehend Rechtsschutz bekommen, wann immer Folterhandlungen oder Freiheitsentzüge in Rede stehen (...), dass das Kind sofort Rechtsschutz bekommt, hier in Deutschland nicht haben."
Von einer Judikative im Sinne des Kindeswohls gemäß den internationalen Abkommen kann in Deutschland keine Rede sein, so Prestien. Das habe ihn in seiner Tätigkeit als Familien- und Jugendrichter bereits seit 1979 bewogen, eine interdisziplinär besetzte eigene Anwaltschaft für Kinder und Familien zu fordern und diesbezügliche Konzeptionen fächerübergreifend zu erarbeiten. Hierbei gehe es nicht nur darum, im Einzelfall die Rechte der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen, sondern diese auch vor möglichen Fehlbeurteilungen und Fehleinschätzungen staatlicher Stellen, die zur Hilfe berufen sind, zu schützen. Speziell die Entscheidung des Familiengerichts Leipzig ist für Prestien nicht der Weisheit letzter Schluss.
"Denn aus meiner Sicht ist das ganze Infektionsschutzgesetz (...) das Papier nicht wert, auf dem es steht. Weil es mit der Verfassung nichts zu tun hat, weil es mit den internationalen Vereinbarungen nichts zu tun hat, und weil es den Eltern, den Erwachsen nicht nur die Kompetenz wegnimmt, für sich selbst zu sorgen, sondern – wir alle werden zu Kindern gemacht, die schön brav das machen sollen, was uns irgendeiner vorschreibt. Das sollte (...) seit der Menschenrechtserklärung von 1948 eigentlich allmählich beendet werden."
Ein Mitglied des Ausschusses verwies auf die Verfassungsbeschwerde des Rechtswissenschaftlers Prof. Dietrich Murswiek zur aktuellen Änderung des Infektionsschutzgesetzes und erinnerte darüber hinaus an die Verbrechen der Nazidiktatur und die Nürnberger Prozesse als den Ursprung der Menschenrechtskonvention. Als Anwalt sehe er in dem Beschluss des Familiengerichts Leipzig einen "krassen Rechtsbeugungsfall und möglicherweise auch Schlimmeres" zur Einschüchterung und Abschreckung, um weitere Fälle solcher Kindesschutzersuchen an Familiengerichten zu unterbinden.
Paragraf 1666 BGB bestimme deutlich die Aufgabe des Familiengerichts, von Amts wegen zum Schutz des Kindeswohls unmittelbar tätig zu werden, wenn es Kenntnis von Gefährdungen des Kindeswohls hat. Hier hat das Familiengericht nicht nur Kenntnis, sondern drei verallgemeinerungsfähige Rechtsgutachten zur Situation der Kinder infolge der Corona-Maßnahmen erhalten, erklärte der Jurist des Ausschusses.
"Und da zu sagen, das interessiert mich alles nicht, das ist schon ein bisschen seltsam. Man muss sich nur einmal zwei Jahre zurück entsinnen. Was wäre denn passiert, wenn eine Mutter vor zwei Jahren zum Familienrichter gekommen wäre und gesagt hätte: Hier, der Typ ist völlig durchgeknallt, der zwingt die ganzen Kinder in dieser Schulklasse, Masken aufzusetzen. Der zwingt die, Abstand zu halten. Hätte er dann auch gesagt: 'Ist mir doch egal. Jetzt erhältst du erst einmal 18.000 Euro Kosten aufgebrummt.' Das kann man sich nicht vorstellen."
Hier handele es sich offenbar um Gesinnungsjustiz.
"Letzten Endes wird das ja einfach nur abgelehnt, weil man sagt: 'Nö, diese Sachverständigen kann man nicht ernst nehmen. Die sind ja Corona-Gegner.' Das ist so, als würde ich sagen: 'Diesen Richter kann man nicht ernst nehmen. Der ist ja katholisch. Oder der ist evangelisch (...).' Also, in der Sache weicht er allem aus. Schafft es aber dann zu sagen: 'Aber Kosten (...), die brumme ich dir auf.' Und zwar vollkommen illegal, deshalb mein Vorwurf der Rechtsbeugung. Aber er tut es."
Als Anwalt müsse er sich nicht so zurückhaltend ausdrücken, wie es Prestien gegenüber seinen Richterkollegen tue, sondern könne als Interessenvertreter Klartext sprechen.
"Ich finde, das ist eine Riesensauerei, die da passiert ist. 1666 [BGB] hat einen klaren Inhalt."
Auch das Verstecken hinter der vermeintlichen Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte, um gegen die Verordnung vorzugehen, greife nicht. Das sei eine Frage des gesunden Menschenverstandes.
"Wenn ich als Richter gefordert bin, mich in solchen Situation einzusetzen, dann kann ich nicht sagen: Ich warte erst einmal, bis irgendeiner auf die Idee kommt, ein Normenkontrollverfahren anzustrengen. Das geht doch nicht."
Das müsse man klar und deutlich anprangern, gerade um zu verhindern, dass diese Einschüchterungen dazu führen, ihr offenkundig angestrebtes Ziel zu erreichen, dass sich niemand mehr ins Familiengericht traut, um seine Kinder zu schützen.
Prestien stimmte dem zu. Jeder von uns müsse auf seine Art und Weise wach werden und sich die Kenntnisse verschaffen, mit denen er aktiv werden könne.
"Es ist enorm wichtig, dass wir aus der Opfersituation herausgehen. Dass wir nicht mehr die kleinen Kinder sind, die widerspruchslos hinnehmen, was passiert, sondern dass wir etwas tun."
Es gebe zudem aus wissenschaftlicher Sicht noch viel fundamentalere Gründe, weshalb das Infektionsschutzgesetz "möglicherweise in die Tonne gehört". Wenn man die Forschungserkenntnisse ernst nehme, dann befinde man sich in einer ähnlichen Situation wie bei der Frage, ob die Erde rund oder eine Scheibe sei. Der Scheibe entspreche die Vorstellung von Gesundheit, die durch Anwendung von Produkten der Pharmaindustrie erreicht werde. Dem Forschungsstand entspreche aber etwas anderes. Unser eigener Zustand sei maßgeblich für unsere Gesundheit. Es gehe um Ursachen, nicht um Symptome. Was hier geschehe, sei eine symptomatische Orientierung.
Die Arbeit der Familienrichter ist ebenfalls an den Symptomen orientiert, erinnerte Prestien. Er selbst habe in seiner Zeit als Richter einen anderen Weg gewählt als den der autoritären Ausrichtung symptomatischer Behandlungen, die er für völlig verfehlt halte.
"Ich bin aus der Rolle des Richters als Entscheider ausgestiegen und habe mich zum Friedensrichter entwickelt, der in Deutschland letztlich das gemeinsame elterliche Sorgerecht durchgesetzt hat."
Insgesamt habe man aber immer noch die Situation, dass wir nicht daran glauben, die Leute könnten ihre Probleme selbst handhaben. Wir glaubten stattdessen, es müsse eine Regierung geben, die das für uns kläre und entsprechende Macht ausübe. In der jetzigen Situation seien Grenzen erreicht und Straftatbestände verwirklicht, dass es für jeden von uns Zeit werde, nicht nur Stopp zu sagen, sondern sich darüber klar zu werden, dass man eine solche Behandlung nicht mehr brauche.
Der Ausschuss teilte diese Einschätzung Prestiens. Es gehe um das Respektieren eigener Entscheidungen und eigener Meinungen. Die Situation sei hochbrisant und spitze sich in einer solchen Entscheidung wie der in Leipzig zu.
"Da wendet sich eine Mutter Hilfe suchend an ein Gericht und bekommt erstens nichts und zweitens eine Bestrafung. Das ist die Perversion des Rechts."
Prestien verwies auf die Hilfsanfragen, die viele Lehrer an ihn stellen. Diesen gehe es seinem Erleben nach genauso schlecht wie den Eltern. Daher komme es darauf an, Rechtskenntnisse zu vermitteln und Stellung zu beziehen. Denn man könne sich auf Artikel 29 der UN-Konvention zu Kinderrechten berufen, die für Deutschland verpflichtend sei.
"Die Vertragsstaaten stimmen darin überein, dass die Bildung des Kindes darauf gerichtet sein muss,
(a) die Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen;
(b) dem Kind Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten und den in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsätzen zu vermitteln;
(c) dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes, in dem es lebt, und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln;
(d) das Kind auf ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie zu Ureinwohnern vorzubereiten. (...)"
Deutlicher könne man es nicht formulieren. Zudem weiß man, dass Kinder durch Vorbilder lernen und reifen, daran, was sie von ihren jeweiligen Bezugspersonen erfahren, erklärte Prestien.
"Dann weiß man, was Kinder aufnehmen in einer Situation, in der die Eltern 'zu Kindern werden', die gehorsam ihre eigenen Kinder verletzen. Und das trägt sich fort über die Generationen."
Das sei nicht nur für die einzelnen Kinder von Bedeutung, sondern betreffe unser aller Zukunft, die Zukunft unseres Landes, auch wenn wir selbst nicht mehr lebten.
Dem schloss sich der Ausschuss an, in den Worten eines seiner Mitglieder:
"Wenn ich mir das alles anhöre, hier wird doch durch die Maßnahmen in geradezu grotesker Weise Kindesmissbrauch institutionalisiert. (...) Wir haben es ja schon von vielen Psychologen gehört. Das, was hier passiert, das wird schwerste Schäden verursachen. (...) Dass da der Notwehrparagraf im Grunde sofort ins Auge sticht, das muss eigentlich jedem einleuchten."
Das alles vor dem Hintergrund eines Krankheitsgeschehens, das nur für sehr wenige Menschen aus Risikogruppen gefährlich sei und Kinder so gut wie überhaupt nicht betreffe.
"Trotzdem betreibt man es jetzt geradezu systematisch und geradezu institutionalisiert, diese Kinder zu missbrauchen und zu traumatisieren. (...) Es gibt ein paar Leute, die haben es einfach zu weit getrieben, und da muss am Ende der Geschichte eine zivil- und auch strafrechtliche Sanktion erfolgen."
"Ich widerspreche dem überhaupt nicht", so Prestien. Er könne nur jeden herzlich darum bitten, sich die Vorschriften der Paragrafen 32 bis 35 StGB zu Notwehr, Nothilfe und Notstand anzuschauen. Auf deren Grundlage könne man als Lehrer und als Eltern berechtigterweise sagen: Das mach ich nicht mit. Eltern sollten ihre Kinder nicht in eine Schule schicken, die die Grundlagen aus der UN-Konvention in Artikel 29 nicht gewährleistet, sondern im Gegenteil ihre Kinder schädigt. Weder Schulen noch Distanzunterricht könnten gegenwärtig ihren Auftrag gegenüber den Kindern erfüllen.
"Wir haben eine Schule, die den Namen nicht verdient. (...) Bevor ich mein Kind einer solchen Gefahr aussetze, kann ich nur hergehen und sagen: 'Ich mache von meinem Notwehrrecht Gebrauch, und das Kind bleibt zu Hause.'"
Er fordere die Lehrer dazu auf, sich auch an ihre Berufsvertretungen zu wenden, um sich dagegen zu wehren, Kindesmisshandlungen wie Testungen und Abstandhalten durchzuführen, die nicht der Aufgabe der Schule entsprechen.
Wolfgang Wodarg berichtete ergänzend zu den Ausführungen Prestiens von der gemeinsamen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) zur "Hospitalisierung und Sterblichkeit von COVID-19 bei Kindern in Deutschland" vom 21. April 2021. Seit Beginn der Corona-Krise wurde in allen Krankenhäusern nach der Häufigkeit der Diagnose COVID-19 bei den insgesamt 14 Millionen Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren in Deutschland geschaut.
"Von diesen 14 Millionen sind in dieser Zeit (...) 1.200 Kinder mit der Diagnose im Krankenhaus gewesen. Und wenn man nach den harten Daten schaut, dann muss man fragen: Wie viele Kinder sind denn an dieser Erkrankung gestorben? Und das sind vier. Vier Kinder sind in über einem Jahr an COVID-19 gestorben."
Damit seien deutlich weniger Kinder an dieser Erkrankung verstorben als im Jahr 2019 an der Influenza. Das sei ein hartes Datum für das tatsächliche Risiko für Kinder bei diesem Krankheitsgeschehen. Auch bei der Altersgruppe der Eltern sterbe kaum jemand. Ebenso sei bekannt, dass Menschen im Alter von über 80 Jahren häufig mit Atemwegsinfektionen nicht fertig würden. Bei Kindern sei das praktisch vernachlässigbar.
Es spitzt sich demgegenüber immer mehr zu, resümierte einer der Juristen des Ausschusses, dass die Kinder die Hauptbetroffenen sind und dass man gezielt auf diese mit den Maßnahmen losgeht. Deshalb habe er den Begriff "institutionalisierter Kindesmissbrauch" gewählt. Dies spiele auch bei einer in Kanada vorbereiteten Sammelklage eine Rolle, sodass der Ausschuss dafür Prestien mit den dortigen Anwaltskollegen vernetzen werde.
Ein weiteres Ausschussmitglied unterstrich abschließend die Situation, in der sich die Eltern befinden:
"Es sind die Kinder, die haben die Menschen geboren. Von Anfang an hat man sich bemüht, ihnen das Beste zukommen zu lassen und sie möglichst traumafrei in die Welt zu bringen. (...) Und jetzt sieht man einen Staat (...) – eine Gemeinschaft soll die Kinder schützen, und das tut sie nicht. Und ich bin in dieser Situation als Eltern, als Mutter, als Vater, hilflos dieser Situation ausgesetzt. (...) Es ist wirklich unerträglich. Es ist auch ein unglaubliches psychisches Leid für die Eltern, sich so hilflos zu erleben und diese Kompromisse machen zu müssen. Ich sehe, mein Kind leidet unter der Maske, es fällt beim Fußballspielen um. Gleichzeitig will es weiterhin mit den anderen Kindern spielen und hat Angst vor der sozialen Ächtung, wenn es ohne Maske unterwegs ist, wo es jetzt beispielsweise attestberechtigt wäre. Was ist das für eine Bredouille, in die die Menschen, die Eltern, die Großeltern, alle Beteiligten gebracht werden? Das ist unerträglich und muss wirklich ein Ende haben."
Prestien bekräftigte dies und erinnerte zusätzlich an die Spaltungen, die sich durch diese Situation selbst innerhalb von Familien ergeben und "unglaublich" sind. Er dankte dem Ausschuss für dessen Aufklärungsarbeit und freute sich auf weiteres Zusammenwirken kritischer Experten verschiedener Fachrichtungen.
BERICHT DES RECHTSWISSENSCHAFTLERS PROF. MARTIN SCHWAB
Schwab zufolge begegnet das neue Infektionsschutzgesetz vor allem in Paragraf 28b durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken, speziell die dort verankerte sogenannte Inzidenz als Zahl angeblicher "Neuinfektionen", die vom Robert Koch-Institut (RKI) bekannt gegeben wird und an die sich automatisch per Gesetz einschneidende Rechtsfolgen wie Ausgangsbeschränkungen knüpfen.
"Da hat man versucht, diesen Tatbestand so zu formulieren, dass das Gericht bitte nicht nachprüft, ob diese Infektionen überhaupt Infektionen sind und ob sie neu sind."
Angesichts der handgreiflichen Defizite der Feststellung der "Inzidenzwerte", die bereits in vorangegangenen Anhörungen sowie im Verfahren vor dem Weimarer Familiengericht behandelt wurden, stelle sich die Frage, ob es nicht doch Möglichkeiten für eine gerichtliche Überprüfung gibt.
Zudem gebe es verfassungsrechtliche Probleme im Gefüge der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern, da laut Artikel 84 Grundgesetz der Vollzug von Bundesgesetzen Aufgabe der Länder sei. Auch die Kultushoheit der Länder werde durch die Vorgaben zur Einschränkungen des Schulbetriebs insbesondere des Präsenzunterrichts berührt.
Bei den Ausgangssperren gehe es um Artikel 104 Grundgesetz. Freiheitsentziehende Maßnahmen bedürfen eines richterlichen Beschlusses. Ein solches Gesetz hätte man nicht ohne vorheriges Befragen der Gerichte auf den Weg bringen sollen.
Zu den Geschäftsschließungen habe er sich bereits in einer der ersten Sitzungen des Ausschusses geäußert. Es gilt weiterhin die Verletzung von Artikel 12 Grundgesetz, so Schwab.
"Wenn man einem Unternehmer verbietet, Geld zu verdienen, ohne ihm zu sagen, wo es stattdessen herkommt. Es ist immer noch kein klagbarer Entschädigungsanspruch in Paragraf 56 Infektionsschutzgesetz für den Fall normiert, dass aufgrund des Infektionsschutzgesetzes der Laden dichtgemacht wird. Dass man stattdessen Hilfsprogramme als Almosen auflegt, hilft uns nicht weiter. (...) Ohne einen klagbaren und im einstweiligen Rechtsschutz durchsetzbaren Entschädigungsanspruch kann man so etwas eigentlich überhaupt nicht machen."
Nach dieser Skizzierung der Hauptangriffspunkte beim Infektionsschutzgesetz konzentrierte sich Schwab auf die Problematik des sogenannten Inzidenzwerts.
"Die einzige Tatbestandsvoraussetzung dafür, dass kraft Gesetzes ohne zwischengeschalteten Vollzugsakt drastische Beschränkungen der bürgerlichen Freiheiten, der Grundrechte, greifen, ist eine Zahl, die vom Robert Koch-Institut verkündet wird. Das zwingt mich zu der Frage: Was ist denn eigentlich die Verkündung des Inzidenzwerts? Die Ansage, das Gericht überprüft nicht, ob das Robert Koch-Institut den Inzidenzwert zutreffend ermittelt hat, ist eine Verletzung von Grundgesetz Artikel 19, Absatz 4. Die Voraussetzung der Grundrechtseingriffe unterliegen (...) der vollen richterlichen Kontrolle."
Auch die bekannten Fälle von eingeschränkter richterlicher Kontrolle etwa bei höchstpersönlichen Prüfungsleistungen bedeuteten hier keine Ausnahme. Ein Entfallen richterlicher Kontrolle könne vor dem Grundgesetz keinen Bestand haben. Die Frage sei, ob man das Infektionsschutzgesetz dafür dem Bundesverfassungsgericht vorlegen muss, oder ob bereits andere Gerichte ein Einfallstor für die richterliche Kontrolle haben.
Die Verkündung des Inzidenzwerts durch das RKI ist kein Vollzugsakt, denn ein solcher stünde nur den Ländern zu. Diese wiederum müssten hierfür einen Rechtsakt mit Bindungswirkung, also einen Verwaltungsakt, das heißt, eine Maßnahme einer Behörde zur Regelung eines Einzelfalls veranlassen. Die Verlautbarung des Inzidenzwerts regelt laut Schwab aber nichts.
"Wir, das RKI, haben festgestellt, dass in den vergangenen sieben Tagen so und so viele Neuinfektionen da sind. Das ist eine Wissenserklärung. Das ist keine Regelung. Und schon gar nicht betrifft sie einen Einzelfall. Sie betrifft eine ganze Region. Und deswegen sehe ich auch nichts, weswegen diese Handlung bindend sein sollte."
Das schlagende Argument für eine richterliche Kontrolle finde sich allerdings in den öffentlichen Dokumentationen des RKI selbst, da die dortige Falldefinition (Stand 23.12.2020) nicht der Definition des Infektionsschutzgesetzes entspricht. Dort heißt es in Paragraf 2:
"Ein Krankheitserreger ist ein vermehrungsfähiges Agens, das eine Krankheit verursachen kann."
Und Infektion wird definiert als:
"Die Aufnahme eines Krankheitserregers – also eines vermehrungsfähigen Agens – und dessen Vermehrung im menschlichen Körper."
In seiner Falldefinition schreibt das RKI unter Punkt D, "labordiagnostisch nachgewiesene Infektion bei nicht erfülltem klinischen Bild":
"Labordiagnostischer Nachweis mittels Nukleinsäurenachweis oder Erregerisolierung oder labordiagnostischer Nachweis mittels Antigennachweis bei bekanntem klinischen Bild, das die Kriterien für COVID-19 nicht erfüllt. Hierunter fallen auch asymptomatische Infektionen."
In dieser Definition wird nicht nach der Vermehrungsfähigkeit des Erregers gefragt, betonte Schwab. Diese ist bekanntermaßen nicht durch PCR-Tests und Antigentests unmittelbar nachweisbar. Für die PCR-Tests dokumentiert dies unter anderem ein amtliches Schriftstück des Berliner Abgeordnetenhauses (Drucksache 18/25212), in dem der Berliner Senat bestätigt, dass ein PCR-Test nicht zwischen einem "vermehrungsfähigen" und einem "nicht-vermehrungsfähigen" Virus unterscheiden kann.
Auch im Epidemiologischen Bulletin 39/2020 des RKI heißt es:
"Dass man in Anbetracht der vorgefundenen Studienlage das Virus auch Wochen nach überstandener Infektion, also wenn sich schon gar nichts mehr vermehrt, noch immer im Abstrich nachweisen kann. Das heißt, diese Person ist nicht mehr ansteckungsfähig. Das steht da ausdrücklich drin."
Unter den Autoren dieser Information ist der Präsident des RKI, Prof. Lothar Wieler, gelistet.
"Herr Wieler weiß also ganz genau, dass ein Labortest kein vermehrungsfähiges Agens nachweist. Weil er an dieser Publikation mitgewirkt hat."
Wenn ein Richter einen solchen im Gesetz definierten Tatbestand vor sich hat und die zuständige Behörde selbst eine davon abweichende Falldefinition für diesen Tatbestand verwendet, dann, so Schwab, bleibt diesem Richter doch gar nichts anderes übrig, als zu sagen: Dann muss ich selbst Beweis über die tatsächliche Anzahl der Infektionen erheben. Diesen könne man durch Vernehmung des Präsidenten des RKI führen, der dann erklären müsste, wie die Ermittlung des Inzidenzwerts zustande kommt.
Darüber hinaus müssen die Infektionen "neu", das heißt, innerhalb der zurückliegenden sieben Tage erfolgt sein. Dass in die vom RKI vermeldeten Inzidenzwerte allerdings auch wesentlich ältere Daten eingehen, hatte der Ausschuss bereits in einer früheren Sitzung behandelt. Schwab zog aus all dem den Schluss:
"Weder ist der Nachweis geführt, dass das Infektionen sind, noch ist der Nachweis geführt, dass diese Infektionen, wenn es denn welche sind, neu sind. Da muss ich mich zur verfassungskonformen Auslegung dieses Paragrafen 28b als Richterin und Richter hinsetzen und sagen: 'Leute, wenn ihr selber schon sagt, dass ihr eine Falldefinition zugrunde legt, die nicht auf einer Subsumtion unter das Infektionsschutzgesetz beruht, dann kann ich diese Verlautbarung als reine Wissenserklärung meiner Rechtsanwendung nicht zugrunde legen, sondern dann muss ich Beweis erheben: Wie viele Infektionen waren es denn wirklich?"
Dann stelle sich die Frage, welches Gericht darüber entscheiden kann, wenn hier kein Vollzugsakt der Verwaltung vorliegt. Für Schwab gibt es drei mögliche Szenarien.
Zum einen über eine Feststellungsklage, beispielsweise darüber, dass man sein Geschäft wieder öffnen dürfe. Dann könnte das Verwaltungsgericht diesen Beweis erheben, was allerdings üblicherweise nur im Hauptsacheverfahren geschehe. Da ein solches zumeist erst nach vielen Monaten stattfinde, helfe es einem klagenden Unternehmer in dieser Situation nicht. Dieser sei zwischenzeitlich pleite. Angesichts der zu beobachtenden Praxis der Verwaltungsgerichte könne man auch nicht mit einem einstweiligen Rechtsschutz zugunsten einer vorläufigen Öffnung bis zur Entscheidung in der Hauptsache rechnen.
"Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz kommt, wenn überhaupt, zu spät."
Die zweite Möglichkeit sei ein bewusster Verstoß gegen die Corona-Maßnahmen. Im Rahmen eines Bußgeldverfahrens könne man dann Beweisaufnahme darüber begehren, dass die Voraussetzung für die Erteilung eines Bußgeldes vorliegt. Dafür müsse es einen Verstoß geben und für diesen wiederum einen gewissen Inzidenzwert. Auch hierzu könne der RKI-Präsident vernommen werden. Als Beamter benötige dieser allerdings eine Aussagegenehmigung, die möglicherweise auf dem Klageweg vor dem Verwaltungsgericht erstritten werden muss. Ansonsten unterliege es der freien Beweiswürdigung des Gerichts im Bußgeldverfahren, ob es der Behauptung folgt, die Inzidenz sei in Wirklichkeit viel niedriger gewesen, sodass kein Verstoß und keine Voraussetzung für die Verhängung eines Bußgeldes vorgelegen haben.
Als dritte Option könne man direkt das RKI angehen, ihm vorwerfen, dass die Zahlen der Inzidenzwerte falsch sind, und es darum bitten, diese richtigzustellen. Vor dem Verwaltungsgericht in Berlin ließe sich der Anspruch gegen das RKI vorbringen, den Inzidenzwert so zu ermitteln, dass er den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes genügt. Das RKI könnte durchaus dazu verurteilt werden, den Inzidenzwert gesetzeskonform festzustellen, also mit Nachweis eines spezifischen vermehrungsfähigen Krankheitserregers, ohne Mehrfacherfassung von Befunden ein und derselben Person sowie ohne Zählung von mehr als sieben Tage alten Befunden. Allerdings stehe man dann bei der Durchsetzung seines gerichtlich bestätigten Anspruchs infolge der Beweislast vor dem Problem, dem RKI in der Folge den Verstoß gegen die gesetzeskonforme Feststellung des Inzidenzwerts nachweisen zu müssen, erklärte Schwab.
"Wir wissen überhaupt nicht, was beim Robert Koch-Institut passiert. Wie genau die Laborwerte nachgeprüft werden, die da gemeldet werden. Ob die einfach so übernommen werden. Ob da wenigstens nachgefragt wird: 'Habt ihr die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom 20. Januar 2021 erfüllt? Habt ihr noch mal nachgetestet, wenn die Testergebnisse nicht mit dem klinischen Befund übereinstimmten? Auf wie viele Primer habt ihr getestet? Auf welche Primer habt ihr getestet?' Das wissen wir ja alles nicht."
Selbst wenn man also irgendwann einmal nach womöglich langjährigen Verfahren bis zu einer letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung das RKI darauf festlegen könne, die Inzidenzen korrekt zu ermitteln, so beiße man sich daran die Zähne aus, dem RKI einen Verstoß dagegen nachzuweisen.
Im Ergebnis stellte Schwab fest:
"Dieser Paragraf 28b Infektionsschutzgesetz ist gezielte Rechtsschutzverweigerung."
Damit wäre zumindest die zweite Option über eine Beweisaufnahme im Bußgeldverfahren geboten, um überhaupt einer verfassungskonformen Auslegung dieses Paragrafen 28b näher zu kommen. Schwab selbst zeigte sich diesbezüglich skeptisch und verwies auf die dann verbleibenden Möglichkeiten vor dem Bundesverfassungsgericht.
"Ob die Gerichte das machen oder ob sie einfach sagen: 'Das RKI hat gesagt, und Ende der Durchsage'. Das ist völlig zweifelhaft. (...) Wenn man es mit der einfachgesetzlichen Auslegung nicht hinbekommt, heißt es, dass dieser Paragraf 28b Infektionsschutzgesetz wegen der Verletzung von Artikel 19, Absatz 4 [des Grundgesetzes] verfassungswidrig ist und dass [dies] natürlich vom Bundesverfassungsgericht festgestellt werden muss."
Wenn sich also Gerichte in solchen zuvor geschilderten Bußgeldverfahren nicht trauten, in die Beweisaufnahmen einzusteigen, dann sollten sie sich wenigstens die Mühe machen, die Sache beim Bundesverfassungsgericht wegen Bedenken der Verfassungsmäßigkeit vorzulegen.
Hinsichtlich der Geschäftsschließungen ohne verfassungsmäßig gebotenen Entschädigungsanspruch und ohne tatsächliche Hilfszahlungen steht er mit der Unternehmerschaft in Kontakt, ergänzte Schwab. Der Ausschuss bestätigte seinerseits entsprechende Unterredungen mit der mittelständischen Wirtschaft, die sich mittlerweile darüber klar zu werden scheint, dass sie kaum darauf hoffen kann, von einem Staat, der sie in diese existenzbedrohende Situation gebracht hat, aus dieser Situation wieder herausgeholt zu werden.
Abschließend stellten sowohl Schwab als auch der Ausschuss übereinstimmend fest, dass die Nerven auf allen Ebenen des Rechtsstaates blank liegen. Das merke man an der Entscheidung des Familiengerichts in Leipzig sowie daran, dass es ein solches Infektionsschutzgesetz tatsächlich in die Gesetzesblätter schafft. Einer der Juristen des Ausschusses verdeutlichte dies mit einer Anekdote aus dem Gerichtssaal. In einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen zwei bisher völlig unbescholtene ältere Damen habe das Gericht deren ärztliche Atteste beschlagnahmt. Als deren Anwalt habe er diese als notwendige Verteidigungsunterlagen in der Verhandlung mitgeführt. Damit beschlagnahme der Staat Beweismittel, die die Unschuld seiner Mandanten beweisen. Man werde sehen, wie sich das weiter entwickelt. In jedem Fall habe man eine neue Eskalationsstufe erreicht. Ausgerechnet in solchen Verfahren wegen kleinerer vermeintlicher Ordnungswidrigkeiten, in denen der Staat nun derart unverhältnismäßig mit aller Härte auftritt.
"Das zeigt, dass man nichts weiter außer Härte zu bieten hat. Man hat keine Argumente. Man hat keine Rechtsstaatlichkeit, auf die man sich stützen kann. Man hat keine Strafprozessordnung, an die man sich hält. Sondern man hat nur noch willkürliche Härte. Das zeigt aus meiner Sicht eigentlich nur, dass wir den Zenit eigentlich schon überschritten haben und dass das System in sich zusammenbricht. (...) Man muss einfach nur standhaft bleiben und den Bluff, der da stattfindet, als das durchschauen, was es ist. Man darf sich von der Kraftmeierei, die man da versucht, einfach nicht einschüchtern lassen, und dann verpufft das alles von alleine."
BERICHT DES KREISVERBANDSMITGLIEDS DER PARTEI dieBASIS ANTONIO SOLO
Solo erklärte einleitend, dass er in dieser Anhörung als Sprachrohr für diverse Lehrkräfte dient, die an ihn herangetreten sind. Es gehe darum, in seinen Augen skandalöse Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Durchführung sogenannter Schnelltests an Schulen in Nordrhein-Westfalen vor dem Ausschuss und der Öffentlichkeit bekannt zu machen.
In einer der regelmäßig an alle Schulen gesendeten E-Mails des Bildungsministeriums des Landes schreibe dieses am 15. März 2021 unter anderem, dass Lehrpersonal lediglich den Kindern und Jugendlichen attestieren und nicht selbst beim Durchführen der Tests, etwa dem "Befüllen der Teströhrchen", tätig werden soll. In der Lokalzeitung Soester Anzeiger sei am 14. April 2021 ein Bericht erschienen, in dem Lehrkräfte beim Befüllen von Teströhrchen gezeigt werden. Offenbar würden Lehrkräfte dazu genötigt, gegen eine direkte Anweisung des Ministeriums zu verstoßen.
Eine weitere dieser "Schulmails" vom 14. April 2021 betreffe Schnelltests der Firma Siemens Health Care. Dabei gehe es um zwei verschiedene Tests, einerseits um einen "Antigen Test" und andererseits um einen "Antigen Selbst-Test". Letzterer sei angeblich für die Eigenanwendung etwa daheim geeignet.
Im Beipackzettel des Antigentests werde dieser als "In vitro"-Test für Labordiagnostik bezeichnet. Er sei nicht für Anwendungen zu Hause oder in der Schule vorgesehen. Solo zitierte aus den Warnhinweisen dieses Tests:
"Lösungen, die Natriumazid enthalten, können explosionsartig mit Blei- oder Kupferleitungen reagieren. Verwenden Sie große Mengen Wasser, um weggeworfene Lösungen in eine Spüle zu spülen."
Natriumazid ist als Gefahrstoff klassifiziert. Auf Wikipedia heißt es dazu unter "Sicherheitshinweise":
"Schon die Inhalation oder die orale Aufnahme kleiner Mengen (beispielsweise 1,5 ml zehnprozentige Lösung) hat starke Vergiftungserscheinungen zur Folge."
Dies war für ihn der Anlass, nach weiteren verfügbaren Informationen zu diesem Stoff zu suchen, erläuterte Solo. Speziell bei den sogenannten Selbsttests für Eigenanwendung, die in den Schulen des Bundeslandes eingesetzt werden. Über den QR-Code auf deren Verpackung gelange man zu Dokumentationen des Herstellers, die man herunterladen könne. Lediglich in dem Dokument "Häufig gestellte Fragen" gebe es einen Hinweis auf Natriumazid.
Dazu sagte der Ausschuss:
"Mit anderen Worten, wir werden hier mit hochgefährlichen Stoffen konfrontiert, ohne dass es irgendeiner mitbekommt."
Solo zufolge besteht der Verdacht, dass hier versucht wird, etwas zu verschleiern, um das Ganze ungefährlich erscheinen zu lassen. Er sei selbst Vater zweier Kinder. In der Schule würden die Kinder dazu genötigt, Chemikalien mit einer Gefahrstoffklassifikation zu handhaben. Angaben zu deren Konzentration in den Tests liegen nicht vor. Auch gebe es keine Schutzausrüstungen.
Auf Nachfrage von Schwab bestätigte Solo, dass es für ihn nach Vorsatz aussieht, wenn die Information des Beipackzettels zum Labortest nicht auf dem Beipackzettel des Schnelltests für Eigenanwendungen daheim oder in der Schule auftaucht.
"Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Hier möchte irgendjemand verschleiern, dass eine hochgefährliche Chemikalie in der Pufferlösung vorhanden ist und diese Tests eigentlich in der Schule nichts zu suchen haben, ganz zu schweigen von Kinderhänden."
Schwab erinnerte daran, dass das Oberverwaltungsgericht Münster die Testpflicht an Schulen in Nordrhein-Westfalen bestätigt hat. Bei Kenntnis dieser Zusammenhänge wäre die Entscheidung des Gerichts womöglich anders ausgefallen.
"Eigentlich müsste man jetzt ermitteln, an welcher Stelle diese Manipulation vorgenommen wurde. Denn offenbar ist in der Verpackung nicht das enthalten, was ursprünglich hätte enthalten sein sollen."
FAZIT UND AUSBLICK
Über Medienberichte ist laut Schwab bereits in einem anderen Fall bekannt geworden, dass sogenannte Corona-Antigenschnelltests, mit denen sich insbesondere Schulkinder testen müssen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können, giftige Chemikalien enthalten können. So habe Hamburg nach entsprechenden Meldungen Tests mit diesen Substanzen aus dem Verkehr gezogen. Daher sollte man über eine Ermittlungsanfrage dem Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit geben, auf diese Hinweise zu reagieren.
Der Ausschuss verabredete mit Solo, gemeinsam eine Presseanfrage an das Kultusministerium zu richten, um diese Vorgänge so schnell wie möglich aufklären zu können, und bedankte sich ausdrücklich bei ihm für diese Warnhinweise.
Im Anschluss folgte eine neuerliche internationale Anhörung mit mehreren Anwälten zur jeweiligen Situation in verschiedenen Ländern und zum weiteren koordinierten Vorgehen zur juristischen Aufarbeitung des Geschehens in der Corona-Krise.
Mehr zum Thema - "Viren", Masken, Tests, Impfungen – zur "neuen Normalität" in der Corona-Krise
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.