
Paris wie Athen? Frankreich droht zum neuen Krisenherd der Eurozone zu werden

François Bayrou war nur ein Zwischenspiel. Der französische Premierminister wird am Montag mit großer Wahrscheinlichkeit sein Amt verlieren – das Misstrauensvotum ist praktisch entschieden.
Sein Sturz aber ist weniger persönliche Niederlage als Ausdruck eines strukturellen Problems: Frankreichs Unfähigkeit, seine Finanzen zu stabilisieren.

Schon heute verschlingen die Rentenausgaben 400 Milliarden Euro jährlich, ein Viertel des Budgets. Der Staat finanziert sich zu einem großen Teil über neue Schulden, die Zinslast liegt bereits bei 67 Milliarden Euro pro Jahr. Bis 2029 könnte sie auf über 100 Milliarden steigen – mehr, als Frankreich für Armee oder Bildung ausgibt.
An den Kapitalmärkten sind die Folgen sichtbar: Frankreich zahlt inzwischen Risikoaufschläge, die an die Zeit erinnern, als Griechenland 2010 das Vertrauen der Investoren verlor. Damals schnellte die Verschuldung Athens hoch, Ratingagenturen stuften das Land herab, und die Zinsen explodierten.
Der Dominoeffekt erfasste Irland, Portugal, Spanien und Zypern. Europa rettete sie mit Notfallfonds und der berühmten „Whatever it takes“-Rede von Mario Draghi.
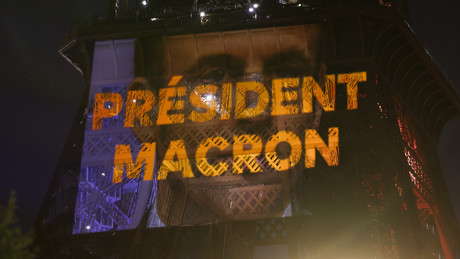
Doch Frankreich ist nicht Griechenland. Mit 3.300 Milliarden Euro Staatsschulden ist es schlicht zu groß, um von der Eurozone aufgefangen zu werden. Eine Intervention des Internationalen Währungsfonds, wie sie Finanzminister Lombard kürzlich ins Spiel brachte, erscheint kaum realistisch.
Paris ist nicht nur ein Mitglied, sondern ein Pfeiler der Währungsunion. Fällt dieser Pfeiler, wankt das gesamte Gebäude.
Politisch ist die Lage ebenso verfahren. Die Nationalversammlung ist in drei Blöcke gespalten, Kompromisse sind Fremdwörter. Die Linke fordert höhere Steuern, die extreme Rechte blockiert jede Reform.
Neuwahlen würden die Kräfteverhältnisse kaum verändern. Auf der Straße formiert sich derweil eine neue Protestbewegung – Gewerkschaften und Aktivisten planen für September Massenblockaden, die an die Gelbwestenkrise erinnern.
Für die EZB ist die französische Krise ein Dilemma. Mit ihrem Transmission Protection Instrument könnte sie theoretisch unbegrenzt Anleihen kaufen, um den Zinsanstieg zu bremsen. Doch ein solcher Schritt käme der Staatsfinanzierung gleich – ein Tabubruch, der die Glaubwürdigkeit der Zentralbank gefährden würde. Zudem geschieht dies in einer Phase, in der die Inflation noch nicht überwunden ist.
Frankreich ist damit nicht nur ein nationales Problem. Es ist der Testfall für die Zukunft der Eurozone. Wenn Paris scheitert, droht Europa erneut ein Flächenbrand wie vor 15 Jahren. Der Unterschied: Heute geht es nicht um Griechenland, sondern um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Währungsunion. Eine Rettung wäre ungleich schwieriger – und vielleicht gar nicht mehr möglich.
Mehr zum Thema – Nur die selbst ernannten Chefs der "Koalition der Willigen" glauben noch an ihre eigene Größe
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.
