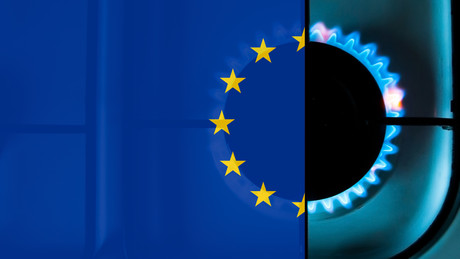China hat den Krieg um grüne Energie bereits gewonnen

Von André Benoit
Während die Vereinigten Staaten unter der Ägide der Trump-Administration laufende Programme für grüne Energie abschaffen und zu einer Politik der fossilen Brennstoffe zurückkehren wollen, hat China demgegenüber als weltweit führendes Land in Bezug auf die industrielle Produktion eine neue Liga erreicht. Während man in Washington über Subventionen und Vorschriften streitet, exportiert Peking ganze Systeme für saubere Energie im industriellen Maßstab und macht dadurch zum Beispiel Afrika zum sichtbarsten Beispiel dafür, wie sehr sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben.
Chinesische Solarkraftwerke, Mininetze und Batteriezentren versorgen Regionen mit Strom, die jahrzehntelang energiearm waren, und zwar mit neuester Hardware, mit der die US-amerikanische Industrie hinsichtlich Preis und Menge nicht im Geringsten mithalten kann. Mit jeder neuen Lieferung extrem günstiger Solarmodule dringt Peking tiefer in entsprechende Märkte vor, auf die Washington einst Einfluss nehmen wollte, und festigt damit Chinas Rolle als dominierende Kraft bei den Technologien, die das nächste Jahrhundert prägen werden.

Die Rivalität ist nicht mehr nur theoretischer Natur. Die eine Seite gestaltet die Zukunft der globalen Energieversorgung, während die andere zusehen muss, wie diese Zukunft außer Reichweite gerät. Die eigentliche Frage ist, wie viel von der sich abzeichnenden neuen Energieordnung letztlich nach chinesischen Vorstellungen gestaltet wird – und welchen Platz die USA darin gegebenenfalls einnehmen werden.
Chinas Industriemaschine
Chinas Aufstieg im Bereich der sauberen Energien ist kein Zufall und auch kein Glücksfall des Marktes. Er ist das Ergebnis einer staatlich geförderten Industriemaschine, die darauf ausgelegt ist, jede Stufe der Solarlieferkette zu dominieren – von der Polysiliziumverarbeitung und dem Wafer-Zuschnitt [in der Elektronik ist ein Wafer (auch Scheibe oder Substrat genannt) eine dünne Scheibe aus Halbleitermaterial, beispielsweise kristallinem Silizium] bis hin zur Batteriechemie und der Speicherung im Netzmaßstab. Kein anderes Land verfügt über etwas Vergleichbares.
Die Solarstromkapazität im Versorgungsmaßstab erreichte in China im Jahr 2024 mehr als 880 Gigawatt (GW), mehr in jedem anderen Land der Welt. Allein der jährliche Zuwachs übertraf die gesamte installierte Solarleistung vieler Nationen.
Diese Größenordnung ist nicht nur beeindruckend, sondern verändert auch die Wirtschaftlichkeit der Branche grundlegend. Chinesische Solarmodule kosten mittlerweile nur noch 0,07 bis 0,09 US-Dollar pro Watt, ein Niveau, das westliche Hersteller selbst mit Subventionen nicht erreichen können.
Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein Modell, das auf Skaleneffekten, öffentlichen Subventionen und einer Industriepolitik basiert, deren Schwerpunkt auf Kostenkontrolle und Integration der Lieferkette liegt. Diese Kombination ermöglicht es China, die Preise zu drücken und gleichzeitig ein Fertigungsökosystem zu stärken, das weiterhin schneller wächst, als das Land intern absorbieren kann.
Chinas rasantes Produktionswachstum hat die Binnennachfrage bei Weitem übertroffen und zu einem in westlichen Politikdebatten "Überkapazitäten" genannten industriellen Vorteil geführt, mit dem China nun seine globale Expansion vorantreibt. Indem Peking diesen Überschuss in eine strategische Exportindustrie umwandelt, ist es in der Lage, extrem günstige Hardware in einem Umfang anzubieten, mit dem westliche Hersteller nicht mithalten können. So erschließt China neue Märkte und stärkt seine Position in der globalen Energiewirtschaft.
Die Führung in Peking macht deutlich, dass die Energiewende kein Experiment, sondern eine strategische Ausrichtung ist. In seiner Rede vor den Vereinten Nationen im Jahr 2025 bezeichnete Präsident Xi Jinping den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft als historischen Kurs, den die Länder ohne zu zögern einschlagen müssten. Dabei handelte es sich weniger um einen diplomatischen Appell als vielmehr um eine Absichtserklärung: China betrachtet die Energiewende als strategisches Feld, das es gestalten will, während andere noch darüber debattieren, ob sie sich dazu verpflichten sollen.
Afrika: Ground Zero für Chinas grüne Expansion
Wenn es eine Region gibt, die das Ausmaß von Chinas Vorstoß im Bereich der sauberen Energie verdeutlicht, dann ist es Afrika. Der Kontinent verfügt über eines der weltweit größten Solarpotenziale und gleichzeitig über einige der schwächsten Energiesysteme. Für Peking ist diese Kombination eine Chance.
Rund 600 Millionen Afrikaner haben immer noch keinen zuverlässigen Zugang zu Strom. Ganze nationale Stromnetze basieren auf veralteter Infrastruktur, Stromausfälle können Stunden oder Tage dauern, und Dieselgeneratoren sind nach wie vor die Standard-Notstromversorgung in allen Bereichen, von Krankenhäusern bis hin zu kleinen Geschäften. In vielen Ländern liegen die Kosten für Dieselstrom bei 0,70 US-Dollar pro Kilowattstunde – ein unerschwinglicher Preis für Haushalte und eine ständige Belastung für lokale Unternehmen.
Chinesische Solarprojekte haben in diesem Umfeld sofortige Auswirkungen. In Nigeria getestete Mininetze liefern beispielsweise Strom für etwa 0,16 US-Dollar pro Kilowattstunde, und die anfänglichen Investitionskosten amortisieren sich innerhalb weniger Monate. Der Unterschied ist nicht marginal, sondern transformativ. In einigen ländlichen Regionen bieten chinesische Anlagen die erste stabile Stromversorgung, die die Menschen in ihrem Leben gesehen haben.
Das Ausmaß der Einführung beschleunigt sich. Von Juni 2024 bis Juni 2025 stiegen die afrikanischen Importe chinesischer Solarmodule um 60 Prozent – von 9,4 Gigawatt auf 15 Gigawatt. Allein Südafrika kaufte 3,7 Gigawatt. Die Importe Nigerias vervierfachten sich auf 1,7 Gigawatt. Die Importe Algeriens stiegen um das 33-Fache. Diese Zahlen spiegeln mehr als nur die Nachfrage wider. Sie zeigen, dass China zum Standardlieferanten für einen Kontinent wird, der sich, wenn auch ungleichmäßig, in Richtung einer Ära der sauberen Energie bewegt.
Der Ansatz Pekings kombiniert Hardware, Finanzierung und Infrastruktur in einem Paket. Behörden, staatliche Banken und Unternehmen wie PowerChina kümmern sich um die gesamte Kette: Standortbegutachtung, Bau von Anlagen, Lieferung von Ausrüstung, Bereitstellung von Ingenieuren und Strukturierung langfristiger Rückzahlungen. Afrikanische Regierungen müssen sich nicht mit fragmentierten Auftragnehmern oder westlichen Kreditgebern auseinandersetzen, die ihnen politische Bedingungen auferlegen. China liefert ein schlüsselfertiges System – von Solarmodulen über Batterien bis hin zu Wartungsteams.
Das Forum für chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit (FOCAC) bildet das diplomatische Rückgrat dieses Systems. In den jüngsten Aktionsplänen wird der Ausbau von Solar-, Wind- und Wasserkraft sowie neuen Wasserstoffprojekten und der Bau von kohlenstoffarmen Industriezonen zugesagt. Diese Vereinbarungen verbinden die Energieentwicklung mit einer umfassenderen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und vertiefen die Rolle Pekings weit über einzelne Projekte hinaus.
Der Gewinn für China liegt unmittelbar auf der Hand. Jede neue Anlage bindet afrikanische Staaten an chinesische Standards und chinesische Lieferketten. Der Zugang zu Mineralien – Kobalt, Mangan, Graphit – erfolgt oft über parallele Vereinbarungen, die mit denselben Infrastrukturprojekten verbunden sind. Politisch positioniert sich Peking als strategischer Entwicklungspartner – eine Botschaft, die auf einem Kontinent, der seit Langem von westlichen Auflagen und langsamen Lieferungen frustriert ist, gut ankommt.
Marcus Vinícius de Freitas, Politikexperte am Policy Center for the New South, erläuterte dazu in einer Schwerpunktanalyse für das Jahr 2025:
"Die Entwicklung Afrikas sollte strategischen und nicht transaktionalen Zielen folgen. Hier bietet sich China eine plausible Chance. Durch die Umstellung von einem projektorientierten Engagement auf ein wirklich partnerschaftliches Modell werden chinesische Investitionen besser mit den strategischen Visionen Afrikas in Einklang gebracht."
Die neue Soft Power
Chinas Expansion ist politischer Natur. Systeme für saubere Energie schaffen eine eingebaute Abhängigkeit, die sich mit der Zeit vertieft. Solarmodule erfordern kompatible Wechselrichter. Batterien sind auf bestimmte chemische Zusammensetzungen angewiesen. Intelligente Stromnetze laufen mit proprietärer Software. Sobald ein Land chinesische Systeme einführt, wird ein Wechsel des Lieferanten unerschwinglich teuer und technisch riskant.
Peking verstärkt dieses Modell durch sogenannte "kleine und schöne" Projekte, so mit modularen Anlagen für saubere Energie, die die mit Megaprojekten verbundene Gegenreaktionen vermeiden. Viele davon sind mit Vereinbarungen verbunden, die chinesischen Unternehmen Zugang zu wichtigen Mineralien wie Kobalt, Mangan und Graphit gewähren. Infrastruktur erschließt Ressourcen, Ressourcen garantieren die Rückzahlung. Der Kreislauf versorgt sich selbst.
Diese Form der Einflussnahme ist in der Weltpolitik nichts Neues. Sie erinnert an das klassische Muster der "Öl-Diplomatie" im 20. Jahrhundert, als die Kontrolle über die Energieversorgungsketten Allianzen, Abhängigkeiten und geopolitische Sphären prägte. China passt dieses Modell nun an das Zeitalter der sauberen Energie an und nutzt Solarhardware, Batteriesysteme und Netzinfrastruktur, um dort Einfluss zu gewinnen, wo einst Öl die Macht bestimmte.
Afrikanische Analysten weisen bereits auf diesen Wandel hin. Fikayo Akeredolu, Forscher für chinesisch-afrikanische Beziehungen in Oxford, bemerkt dazu:
"Im Gegensatz zum Dakar-Aktionsplan von 2021, in dem Öl und Gas ausdrücklich erwähnt wurden, konzentriert sich der Plan von Peking auf die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien und die Stromversorgung mit sauberer Energie. Dies signalisiert eine entscheidende Abkehr von Projekten mit fossilen Brennstoffen hin zu einem anderen Modell der Einflussnahme."

Die internationale Konkurrenz hat Mühe, darauf zu reagieren, und selbst ihre ehrgeizigsten Initiativen konnten mit Chinas Geschwindigkeit, Umfang und Preisgestaltungsmacht nicht mithalten.
Warum niemand mit China mithalten kann
Der globale Wettstreit um die Vorherrschaft im Bereich der sauberen Energien wird oft als Wettbewerb der Ideen oder Klimastrategien dargestellt. In der Praxis handelt es sich jedoch um einen Wettbewerb der Kapazitäten. Dabei verfügt derzeit nur ein Land über die Größe, die Lieferketten und die politischen Mechanismen, die für die Gestaltung des Wandels erforderlich sind. Die Vereinigten Staaten, Europa, die Golfstaaten und Russland haben alle Ambitionen, aber keines dieser Länder kann mit dem mithalten, was China bereits aufgebaut hat.
Washingtons Position wird weniger durch technologische Grenzen als durch politische Instabilität bestimmt. Unter Donald Trump wurde die staatliche Förderung erneuerbarer Energien zurückgefahren, Umweltprogramme wurden abgeschafft und die langfristige Planung wurde unterbrochen. Mit jedem Wahlzyklus werden die Energieprioritäten der USA neu festgelegt, was eine nachhaltige Industriepolitik nahezu unmöglich macht.
Die USA können innovativ sein. Sie können Subventionen gewähren. Aber sie können nicht mit einem vertikal integrierten chinesischen System konkurrieren, das Hardware zu einem Zehntel der US-Preise produziert und auf Anfrage Gigawatt an Ausrüstung liefert. Zölle und entsprechende Rhetorik schließen diese Lücke nicht.
Europa präsentiert sich als globaler Vorreiter im Klimaschutz, doch seine Energiewende hängt stark von chinesischen Komponenten ab – von Solarmodulen, Batterien, Rohstoffverarbeitung, Wechselrichtern und Netzhardware. Versuche, die heimische Produktion wieder aufzubauen, scheitern an hohen Produktionskosten, fragmentierten Entscheidungsprozessen und jahrelanger Auslagerung.
Selbst große Akteure spüren die Belastung. Im Jahr 2025 stellte der Automobilkonzern Volkswagen aufgrund der schwachen Nachfrage den Betrieb in zwei deutschen Elektrofahrzeugwerken ein. Spanien war auf 2.000 chinesische Techniker angewiesen, um eine neue Batteriefabrik von CATL–Stellantis in Betrieb zu nehmen. Europa hat Ziele und eine Doktrin, aber nicht die industrielle Tiefe, um diese unabhängig umzusetzen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien investieren aggressiv in erneuerbare Energien in Afrika. Masdar und ACWA Power sind zu wichtigen Akteuren in der Wind- und Solarenergieentwicklung geworden. Ihre Stärke liegt jedoch im Finanzbereich – im Projektkapital, nicht in der Fertigung. Sie kontrollieren nicht die weltweite Produktion von Solarmodulen, Batterien oder Netztechnologien. Sie können Projekte sponsern, aber sie können keine Lieferketten umgestalten.
Russland behält durch die Kernenergie eine sichtbare – und in einigen Fällen strategisch wichtige – Präsenz in Afrika. Das 28,75 Milliarden Dollar teure Kernkraftwerk El Dabaa in Ägypten ist das Vorzeigeprojekt, weitere Projekte in Äthiopien, Niger und Südafrika sind in Planung.

Aber Kernkraft ist keine Lösung für den Masseneinsatz. Sie kann nicht mit billigen modularen Solaranlagen konkurrieren, die innerhalb weniger Monate gebaut werden können. Der Einfluss Russlands ist konzentriert und langfristig, aber auf kontinentaler Ebene nicht transformativ.
Jeder wichtige Akteur hat seine Stärken. Keiner kann jedoch mit Chinas Fähigkeit mithalten, das gesamte Paket zu liefern: Produktionskapazitäten, kostengünstige Hardware, schlüsselfertige Infrastruktur, Finanzierung und politische Beständigkeit.
Das Ergebnis ist ein strukturelles Ungleichgewicht. Während die USA und die EU über Rahmenbedingungen und Anreize debattieren, bindet China ganze Regionen in sein Energieökosystem ein. In diesem Wettlauf sind Geschwindigkeit und Umfang wichtiger als Erklärungen. Und China verfügt über beides.
Der Aufstieg des Elektrostaates
Chinas Aufschwung im Bereich der sauberen Energien markiert die Entstehung eines neuen geopolitischen Modells: des Elektrostaates. Anstatt seine Macht durch Kohlenwasserstoffe oder militärische Allianzen zu projizieren, nutzt Peking die Kontrolle über die Technologien und Lieferketten, die das globale Energiesystem der Zukunft bestimmen werden.
Im letzten Jahrhundert konzentrierte sich die Macht auf Ölquellen und Pipelines. Heute dreht sich alles um Silizium, Lithium, Kupfer und die Infrastruktur, die mit diesen Rohstoffen Strom erzeugt. China dominiert jede Stufe dieser Kette.
Der dadurch entstehende Einfluss weitet sich automatisch aus. Jeder mit chinesischer Technologie gebaute Solarpark benötigt chinesische Wartungsdienste und Ersatzteile. Jede heute installierte Batterie garantiert Verträge für morgen. Mit der Zeit entwickeln sich diese Abhängigkeiten zu politischer Annäherung und langfristiger wirtschaftlicher Zusammenarbeit.
Internationale Organisationen warnen, dass solche Ungleichgewichte die globale Energiesicherheit gefährden. China hört diese Warnungen – und baut weiter.
Saubere Energie wird zu einer Grundlage geopolitischer Annäherung. Länder, die sich in Chinas Energieökosystem integrieren, werden jahrzehntelang davon abhängig sein. Und Peking gestaltet dieses System schneller, als jeder Konkurrent reagieren kann.
Autor André Benoit ist ein französischer Berater, der im Bereich Wirtschaft und internationale Beziehungen tätig ist und einen akademischen Hintergrund in Europastudien und internationalen Studien aus Frankreich sowie in internationalem Management aus Russland hat.
Mehr zum Thema – Energiegerechtigkeit als neues Konzept der globalen Entwicklung
RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.