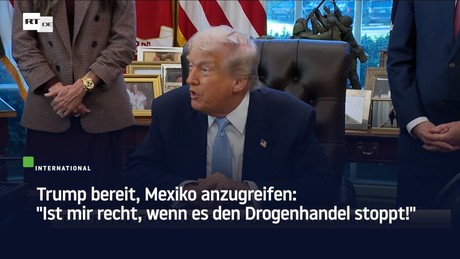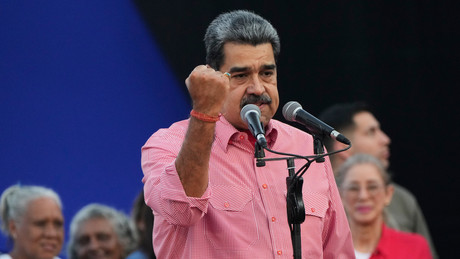
Die USA wählen zwischen drei militärischen Zielen in Amerika
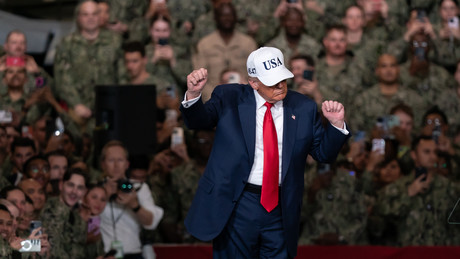
Von Dmitri Bawyrin
Donald Trumps Ziel Nummer eins in Lateinamerika ist Venezuela. Ziel Nummer zwei ist Kolumbien. Das dritte Ziel ist Mexiko. Allerdings sind dies bislang nur hypothetische Ziele.
- "Maduro hat den USA schrecklichen Schaden zugefügt. Die Entsendung von US-Soldaten nach Venezuela ist nicht ausgeschlossen."
- "Ich würde mit Stolz die Drogenproduktion in Kolumbien zerstören."
- "Schläge gegen Mexiko, um den Drogenhandel zu stoppen? Das ist für mich in Ordnung."
All dies wurde von Trump während einer Pressekonferenz gesagt.
Der Kampf gegen die Drogenmafia wurde zum Vorwand für alle drei möglichen Militäroperationen. Aber die USA hoffen offensichtlich auf einen politischen Sieg: in den drei Staaten loyale Regime an die Macht zu bringen und im Extremfall die derzeitigen zu dressieren.
Kolumbien kann sich trotz der äußerst aggressiven Äußerungen der Präsidenten beider Länder gegeneinander am sichersten fühlen. Das Pentagon führt bereits Angriffe auf kolumbianische Schiffe durch, die vermutlich Drogen transportieren. Aber damit wird es wahrscheinlich auch schon getan sein. Washington wird nicht in ein Land einmarschieren, das seit vielen Jahren zu den engsten Verbündeten in der Region zählt, sondern die Wahlen im nächsten Sommer abwarten, die die derzeitige Regierung höchstwahrscheinlich verlieren wird.
Mit anderen Worten: Anstatt die Kolumbianer zu einer "Vereinigung unter der Flagge" zu provozieren, werden die USA zum politischen Chaos in Bogotá und zum weiteren Popularitätsverlust des Präsidenten und ehemaligen roten Partisanen Gustavo Petro beitragen. Diese Partie kann mit wenig Blutvergießen gewonnen werden.
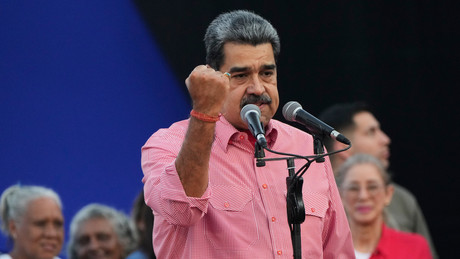
Im Fall von Venezuela hängt der Frieden hingegen am seidenen Faden, aber man muss zugeben, dass dies schon ziemlich lange der Fall ist, und die ganze Zeit über gibt es zwischen Washington und dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro eine Art Feilschen.
Man könnte vermuten, dass Trump, wie man an der Wall Street gerne sagt, "einen Rückzieher macht" (weil er das immer tut). Aber wie aus "Indiskretionen" in den US-amerikanischen Medien hervorgeht, ist eine Invasion immer noch wahrscheinlich: Im Weißen Haus hält man die Lage Maduros für katastrophal. Angeblich muss man ihn nur ein wenig anstoßen, um das seit langem angeschlagene Regime zu beenden und venezolanisches Erdöl auf den Weltmarkt zu bringen.
Das heißt, man rechnet damit, dass es zwar zu Blutvergießen kommen würde, dieses aber geringfügig wäre. Eine begrenzte Intervention würde ausreichen, während der potenzielle Gewinn enorm wäre.
Die US-Luftfahrtbehörde hat die Fluggesellschaften bereits vor den Gefahren von Flügen über Venezuela gewarnt. Nach Informationen der Washington Post und der Nachrichtenagentur Reuters könnte in den nächsten Tagen eine Operation beginnen, die die Entführung Maduros und die Übernahme der Kontrolle über die Ölfelder Venezuelas sowie eine Reihe von Sabotageakten vorsieht.
In Mexiko ist die Lage besonders kompliziert. Wenn die Drohung einer US-Militäroperation auch dort umgesetzt würde, käme es unweigerlich zu erheblichen Opfern.
Dabei ist gerade Mexiko der Hauptlieferant von Fentanyl und Opioiden in die USA, was von den US-amerikanischen Behörden seit langem als Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen wird. In diesem Fall ist der Kampf gegen die Drogenmafia mit Mitteln des Pentagons – zumindest – nur ein Vorwand für einen Machtwechsel, obwohl Washington auch einen Machtwechsel in Mexiko-Stadt nicht ablehnen würde.
Die derzeitige Präsidentin Claudia Sheinbaum setzt, wie versprochen, die Außenpolitik ihres Vorgängers und Mentors Andrés Manuel López Obrador fort. Offiziell handelt es sich um eine Politik der Neutralität. Gegenüber den USA ist sie jedoch eher konfrontativ und zielt häufig darauf ab, den Einfluss Washingtons auf Mexiko-Stadt zu minimieren.
So hat Sheinbaum beispielsweise Protokolle eingeführt, die ausländischen Botschaftern den direkten Kontakt zu mexikanischen Ministern verbieten, und ein Gesetz zur Blockierung von Propaganda aus dem Ausland verabschiedet, dessen Auslöser eine von der US-Regierung finanzierte öffentliche Kampagne über die Gefahren der Migration war.
Noch unangenehmer für die USA ist jedoch ein anderes Gesetz, das zudem verfassungsrechtlich ist: Es verstärkt die staatliche Kontrolle über Ölgesellschaften.
Die Präsidentin ist mit ihren verbalen Provokationen nicht zurückhaltend: Sie bezeichnete die Bombardierung Irans durch die US-Amerikaner als "den größten Fehler der Menschheit" und die von Trump unterstützte Operation Israels in Gaza als "Völkermord", obwohl sie selbst jüdischer Herkunft ist.
Wie so oft bei Staatsoberhäuptern, die den USA gegenüber illoyal sind, hat die mexikanische Präsidentin bereits einen Putschversuch unter dem Deckmantel von Massenprotesten erlebt, die "Freiheit und Gerechtigkeit" forderten. Mitte November stürmte eine Menge, die sich von einer Protestkundgebung mit Tausenden von Teilnehmern abgespalten hatte, den Präsidentenpalast. Der Anlass war die Ermordung des prominenten Oppositionspolitikers Carlos Manzo, der die Regierung beschuldigte, den Drogenhandel zu begünstigen. Die Forderung lautete: Rücktritt von Sheinbaum, die der Korruption und der Zusammenarbeit mit Drogenkartellen beschuldigt wurde. In ähnlicher Weise beschuldigt Trump die Präsidenten von Venezuela und Kolumbien der Korruption und der Zusammenarbeit mit Drogenkartellen.
Der Versuch der US-amerikanischen Medien, dieses Ereignis mit der "Revolution der Generation Z" in Verbindung zu bringen, die zuvor die Regierungen in Nepal und Sri Lanka gestürzt hatten, widerspricht eindeutig der Wahrheit, trotz des jungen Alters der erfolglosen "Revolutionäre".
"Die Revolution der Generation Z" ist noch kein akademischer Begriff, ganz im Gegensatz zum "Arabischen Frühling" beispielsweise. Aber in solchen Fällen geht es um Massenproteste von Jugendlichen unter dem Motto der Korruptionsbekämpfung in Ländern mit autoritären und unpopulären Regierungen. So sehr es Kritiker in den USA auch wünschen mögen, aber das ist bei Sheinbaum nicht der Fall.
Sie ist progressiv und sehr beliebt. Bei den Wahlen stellte sie eine Art nationalen Rekord für den Zeitraum der freien Willensäußerung im Land auf, wobei die Wahlen vor etwas mehr als einem Jahr stattfanden und die Präsidenten in Mexiko für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt werden. Das heißt, von einer Diktatur kann keine Rede sein.
Washington ist einfach wütend darüber, dass Sheinbaums Vorgänger den USA ihre Sonderbefugnisse und ihre Sondervertretung für eigene Operationen gegen die Drogenkartelle entzogen hat. Früher waren solche Operationen die Norm, wobei die Nordamerikaner die mexikanische Regierung oft nicht einmal darüber informierten.
Die Rückkehr Mexikos zum Gewaltmonopol im eigenen Land und zur Souveränität im Bereich der Strafverfolgung ist ebenfalls die Norm. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass López Obrador tatsächlich eine ziemlich seltsame Politik gegenüber den Kartellen verfolgt und sich für eine Strategie des "Umarmens statt Schießens" eingesetzt hatte, bei der versucht wurde, das Problem des Drogenhandels durch Sozialprogramme und nicht durch Gewaltoperationen zu lösen. Dies führte schließlich dazu, dass die mexikanischen Sicherheitskräfte den Präsidenten nicht über ihre Aktionen gegen die Kartelle informierten.
Aber diese Frage ist eine der wenigen, in denen Sheinbaum nicht ganz dem Beispiel ihres Mentors folgt: Sie geht härter gegen die Kartelle vor. Insbesondere hat sie den Sicherheitskräften mehr Befugnisse übertragen und die Bekämpfung der Kriminalität neben der Energie- und Sozialpolitik zu einer ihrer Prioritäten gemacht. Infolgedessen ist die Zahl der Morde im Land innerhalb von sechs Monaten um ein Viertel zurückgegangen.
Der ermordete Oppositionelle Manzo gehörte zum Flügel der pro-Washingtoner Rechten. Er bezeichnete die Verschärfung der Drogenpolitik als unzureichend und erlangte damit eine gewisse Popularität. In einem Land, in dem die Drogenmafia über ganze Armeen verfügt und riesige Gebiete kontrolliert, war ein so vehementer Kämpfer gegen sie natürlich ein Ziel für Anschläge. Die Beteiligung von Sheinbaum an der Ermordung des Oppositionellen, auf die die Anführer der revolutionären Massen anspielten, scheint, gelinde gesagt, weit hergeholt.
Manzo stand als Bürgermeister der Stadt Uruapan unter Bundesschutz. Inzwischen wurde der mutmaßliche Auftraggeber des Mordes festgenommen. Sein Name wurde nicht genannt, aber mexikanische Medien behaupten, es handele sich um den Anführer des Drogenkartells "Nueva Generación Jalisco".
Übrigens sind neben der CIA und der Lateinamerika-Abteilung des US-Außenministeriums die Drogenkartelle die Hauptverdächtigen für die Organisation und Finanzierung der Straßenunruhen in Mexiko-Stadt.
Die Drogenmafia in Mexiko ist keineswegs einheitlich. Das Kartell "Jalisco" ist der schlimmste Feind des größten Kartells "Sinaloa", und auch innerhalb einer Organisation kann es zu heftigen Auseinandersetzungen kommen, beispielsweise kämpfen einige Teile von "Sinaloa" untereinander. Aber alle großen Banden kaufen buchstäblich die arme Bevölkerung in ihren Einflussgebieten auf und handeln dabei nach dem Vorbild des legendären Terroristen und Drogenbarons Pablo Escobar. Viele, die von ihren Gönnern begünstigt werden, sind bereit zu kämpfen, auch gegen den Präsidenten.
Es sieht nicht so aus, als könnte Washington im Moment die Machthaber in Mexiko austauschen, im Gegensatz zu Venezuela, das in dieser Hinsicht echt anfällig ist. Mit seiner Taktik der umfassenden Druckausübung kann Washington ganz gut durchhalten und Sheinbaum dazu bringen, zu seinen Bedingungen zu kooperieren, indem es eine ganze Reihe von Maßnahmen einsetzt – von Zöllen bis hin zu Militärschlägen.
Trump, der eine solche Politik verfolgt, sollte nicht als durch und durch böse angesehen werden. Er würde es vorziehen, sich mit einer Mauer von Mexiko abzuschotten, anstatt Truppen dorthin zu entsenden, aber der Schaden, den die USA durch den mexikanischen Drogenhandel erleiden, ist erheblich, und die Verbreitung von Fentanyl wird als "Epidemie" bezeichnet. Und es ist unwahrscheinlich, dass die mexikanischen Sicherheitskräfte in der Lage sind, allein gegen die Drogenkartelle vorzugehen, die sowohl über Armeen mit Panzern und Drohnen als auch über Armeen von Helfern unter der Zivilbevölkerung verfügen.
Das Ausmaß der US-amerikanischen Militärbeteiligung an der Lösung dieses Problems müsste jedoch so groß sein, dass Trump eher auf verbale Drohungen und politische Erpressung setzen würde, als sich tatsächlich zu einer Invasion in Mexiko zu entschließen.
Zumindest nicht vor einer Invasion in Venezuela, das derzeit tatsächlich nicht vor einer radikalen Entwicklung der Ereignisse gefeit ist.
Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist zuerst am 23. November 2025 auf der Webseite der Zeitung "Wsgljad" erschienen.
Dmitri Bawyrin ist Journalist, Publizist und Politologe mit den Interessenschwerpunkten USA, Balkan und nicht anerkannte Staaten. Er arbeitete fast 20 Jahre als Polittechnologe in russischen Wahlkampagnen unterschiedlicher Ebenen. Er verfasst Kommentare für die russischen Medien "Wsgljad", "RIA Nowosti" und "Regnum" und arbeitet mit zahlreichen Medien zusammen.
Mehr zum Thema - Referendum: Ecuadorianer lehnen Rückkehr von US-Stützpunkten ab
RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.